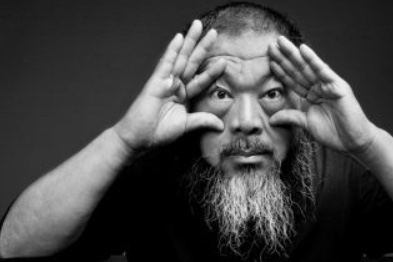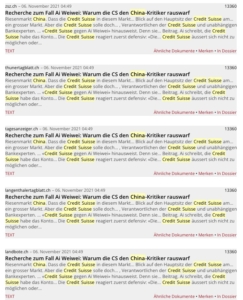Falscher Titel
Die «SonntagsZeitung» schlägt mal wieder Alarm.
ZACKBUM weiss, was passiert ist. Wir können auch ein untrügliches Indiz anführen. Es gibt kein Editorial und auch keinen Artikel von Arthur Rutishauser. Also ist er in den Ferien. Und die Leser haben die Bescherung.
Es ist mal wieder ein Cover, bei dem man sich fragt, wieso eigentlich der Mut fehlt, den Leser mit der Mitteilung zu überraschen: diese Woche ist uns einfach mal wieder überhaupt nix eingefallen.
Stattdessen: «So lebt eine polyamore Familie, Odermatt, Rösti». Zwei Jung-Nationalrätinnen sind sich uneinig. Verblüffend, die eine ist in der SVP, die andere in der SP. Und dann der falsche Titel des neuen Jahres: «Schweizer Berge schrumpfen». Richtig wäre: «SonntagsZeitung» schrumpft.
Beweise gibt es überreichlich: «50 Jahre «Kassensturz»». Nichts gegen Roger («wer hat’s erfunden?») Schawinskis Meisterleistung, aber eine Doppelseite? Und hätte man von Schawi nicht ein besseres Foto nehmen können?
«Der Streit unter den rechten Parteien spitzt sich zu», ein schönes Stück Wunsch- und Blasenjournalismus. Dann erschütternder Mülltourismus, begleitet vom Lacher des Monats: «Ärztin lässt zwei Verletzte liegen, die von ihrem Hund angefahren wurden». Ein grossartiges Stück Qualitätsjournalismus.
Neu daher kommt auch die Seite «Standpunkte». Das Lustigste, nämlich die Bildsatiren von Peter Schneider, sind verschwunden. Stattdessen das brüllend originelle Gefäss «Schnappschuss». Aber immerhin, dank der unablässig quengelnden Jacqueline Badran und des unablässig knödelnden Markus Somm («Warum Deutschland nicht zur Schweiz gehört», auf diesen Titel muss man erst mal kommen), kann die Seite schmerzlos überblättert werden.
Womit man beim Porträt des «interkulturellen Beraters» gelandet wäre, der sich gegen Gewalt in Migrantenfamilien einsetzt. Putziger Titel: «Auch meine Klienten wissen, dass es falsch ist, die Partnerin zu schlagen». Aber sie tun es halt dennoch, da sollte man nicht eurozentrisch und postkolonialistisch unser Wertesystem anderen Kulturen aufzwingen wollen.
Wenn dem Wirtschaftsressort auch mal wieder gar nichts einfällt, dann wärmt es diese Uralt-Geschichte auf: «So viel Food-Waste verursacht der Detailhandel». ZACKBUM warnt: wenn man schon Anfang Jahr den ganzen Stehsatz verballert, dann wird es spätestens in der Sommerflaute ganz dünn. Denn das Stichwort «Food-Waste» ergibt im Medienarchiv SMD in den vergangenen 12 Monaten satte 1886 Treffer …
Aber, ZACKBUM widerspricht seinem Ruf, alles nur negativ zu sehen, dann kommt das Highlight der Ausgabe; ein selten mutiger Peter Burkhardt titelt: «Wo Kettensägen-Mann Javier Milei recht hat». Und legt in der Unterzeile noch nach: der argentinische Präsident sei in Europa als irrer Rechtspopulist verschrien, «dabei ist sein Wirtschaftsprogramm vernünftig und angesichts der Krise des Landes dringend nötig». Vielleicht sollte Burkhardt das mal seinem Kollegen Simon Widmer schonend beibringen.
Aber dann geht es weiter in der Abteilung eingeschlafene Füsse in ungewaschenen Socken: «Die Angst vor der nächsten Finanzkrise wächst». Und wächst und wächst und wächst. Gestern, heute und morgen. Auch der Geldonkel und ehemalige Chefredaktor Martin Spieler hat sich wohl noch nicht wirklich von der Sause an Silvester erholt: «Nur auf Megatrends zu setzen, ist riskant». Mindestens so riskant, wie auf Mikrotrends zu setzen. Oder überhaupt zu setzen.
Dann kommen wir auf das Niveau «Hund überfährt Passanten» zurück: «Wechseljahre mit Anfang 30». Daraus könnte man problemlos eine Serie basteln: «Herzinfarkt unter 30, graue Haare unter 30, MS unter 30, Demenz unter 30, Glatze unter 30, Dritte Zähne unter 30».
Nachdem Jean-Martin Büttner bereits alles Nötige zur «singenden Nervensäge» gesagt hat, darf nun Joan Baez in der SoZ selbst etwas zu sich sagen.
Dann noch etwas reinster Gesinnungsjournalismus: «Putins Aufstieg vom Hinterhofschläger zum neuen Stalin». Allerdings macht der Rezensent dieses sicherlich ausgewogenen Romans die Lektüreempfehlung gleich am Anfang kaputt: «Doch der Ukraine-Krieg macht auch seinen Roman kaputt.» Frage: wieso sollte man das dann lesen? Und bis zu einem neuen Stalin ist’s dann doch noch ein Weilchen hin für den Kremlherrscher.
Dann wieder zurück zu «Hund überfährt Mann»: «Ein Kind, eine Mutter und zwei Väter». Huch. Wir kommen zum Intelligenztest dieser Ausgabe: welchen Einrichtungstipp gibbs Anfang Jahr? Bravo, genau: «Neues Jahr, neue Ordnung». Dann eine brandneue Erkenntnis: «Im Winter schlafen Bäume nur mit einem Auge». Und was machen von Geburt an einäugige so?
Aus der Frühzeit gibt es hingegen Schreckliches zu vermelden, wenn auch nur in Frageform: «Schnitten sich die Menschen der Steinzeit Fingerglieder ab?» Nüchterner geht es in die Gegenwart zurück, wo der Autobauer zu den letzten Mohikanern gehört, die Printinserate schalten: «Der Traum von vergangener Grösse», die SoZ begrüsst das Comeback von Cadillac. Zweiter Intelligenztest, was wird im Reise-Teil thematisiert? Bravo, schon wieder richtig: «Da wollen wir 2024 hin. Traumziele».
Aber, schluchz, schon nach 58 Seiten ist dann Schluss. Mehr würde der Leser auch nicht aushalten …