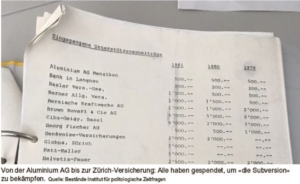«Schnallt eure Gürtel enger und zieht euch warm an!»
In Europa kommt die «Moral vor dem Fressen», in Asien ist es genau umgekehrt. Teil 1
Von Felix Abt
Nachdem die Megaphone des Wertewestens schon zum totalen Wirtschaftskrieg gegen Russland aufgerufen haben, ertönt nun der Schlachtruf gegen China, ohne Rücksicht auf die Folgen für das «gemeine Volk».

Das ehemalige deutsche Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» steht bereits an der Spitze des Propagandakriegs gegen Russland und verbreitet dreiste Lügen, ohne sich dafür zu schämen, wie zu Zeiten ihres chronisch wahrheitswidrig publizierenden Starjournalisten Relotius. Jetzt bläst es zum Angriff auf das nun als brandgefährlich dargestellte China, das diesmal eine viel größere Bedrohung für die Demokratie darstellt als die Taliban am Hindukusch – huch, wo war das noch mal? -, wo NATO-Truppen, darunter auch deutsche Soldaten, angeblich die deutsche Freiheit verteidigten, und auch mehr als die derzeit sehr gefährlichen Russen in der ach so demokratischen Ukraine. Und natürlich fühlen sich zahlreiche deutsche und andere europäische Medien und Politiker bemüßigt, in die gleiche Kerbe zu hauen.


Ein durchschnittlicher litauischer Abgeordneter, der stellvertretend für viele Politiker in den baltischen Staaten steht, unterstellt auf Twitter, China und Russland seien eine grosse – und vermutlich minderwertige – «mongolische» Nation.
Die genannten Beispiele zeigen, wie Politiker und Medien in Europa die Stimmung anheizen und die rote bzw. gelbe Gefahr wieder heraufbeschwören.
Besonders fleißig warnt der in China lebende «Spiegel»-Reporter Georg Fahrion eindringlich vor der unheimlichen Gefahr, die aus China kommt. Er lässt kaum ein gutes Haar an dem Land und spuckt in die chinesische Nudelsuppe, wann immer er kann. Besonders originell ist er dabei nicht, denn die meisten westlichen Journalisten, die sich mit China befassen und im Übrigen kein Chinesisch sprechen, tun mehr oder weniger dasselbe, als hätten sie sich untereinander abgesprochen. Man wird ihnen nie vorwerfen können, China-Versteher zu sein. Als gelernter Politikwissenschaftler kann Fahrion die Lage sicher politisch korrekt einschätzen, wie es seine Chefs in Hamburg und die buntfarbenen Politiker in Berlin von ihm erwarten.
Was er mit vielen seiner deutschen Kollegen gemeinsam hat, ist, dass er noch nie etwas verkaufen musste: keine deutschen Autos, keine Maschinen und keine Adidas-Schuhe, und schon gar nicht in China, wo deutsche Produkte von Millionen von Kunden gekauft werden und Hunderttausende von deutschen Arbeitsplätzen sichern. Die deutsche Autoindustrie zum Beispiel verkauft derzeit 40 % ihrer Autos in China. Ob der hochgelobte «America First»-Verbündete bei einem von deutschen Politikern und Journalisten provozierten Absatzeinbruch aushelfen und viel mehr deutsche Autos kaufen würde, ist zumindest zweifelhaft. Auch haben Fahrion und seine Genossen in den zu intellektuellen Schiessbuden umfunktionierten Redaktionsstuben sicher noch nie Bauteile aus China kaufen müssen, die dazu beitragen, die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähig zu halten, oder in China günstig hergestellte Konsumgüter, ohne die die Kaufkraft und der Wohlstand der deutschen Verbraucher viel bescheidener ausfallen würden.
Die deutschen Unternehmer wissen es, aber nicht vom «Spiegel» und anderen russlandfeindlichen Medien: Der Zugang zu russischen Rohstoffen, der ihnen von gutmenschlichen Ideologen in Politik und Medien verwehrt wird, ist eine echte Gefahr für das Überleben ihrer Unternehmen. Die gut bezahlten Weltverbesserer haben ihren russischen Absatzmarkt bereits ruiniert. Wenn es den Medien wieder gelingt, die Politiker so aufzuwiegeln, dass auch ihr China-Geschäft schnellstmöglich den Bach runtergeht, dann könnte sich in Deutschland im Handumdrehen Armut stark ausbreiten. Während die Massen dann hungern, dürfen sich die abgehobenen politischen und journalistischen Eliten wenigstens in ihrer moralischen Überlegenheit sonnen.
Nun, was sollte sich ein Spiegel-Reporter mit gutem Einkommen um die Auswirkungen der China-dämonisierenden Medien scheren? Selbst wenn Beijing eines Tages genug von seinen Tiraden hat und ihn ausweist, wie es mit einzelnen BBC und anderen Anti-China-Journalisten getan hat, wird es sich auch für ihn auszahlen: Ein lukrativer Buchvertrag, in dem seine Story über den heldenhaften Kampf gegen den brutalen roten (oder gelben) Drachen ausgiebig ausgeschlachtet wird, ist ihm sicher, wahrscheinlich auch andere Vorteile, wie eine Beförderung beim «Spiegel» oder ein vom Steuerzahler besser bezahlter Job in der deutschen Regierungsbürokratie oder in der Brüsseler Eurokratie, bei einem Think Tank oder gar an einer Universität.
Lady Gaga – das große Vorbild für die nach “Freiheit” lechzenden Chinesen!
Der Londoner «Times» zufolge «verkörpert die Sängerin Lady Gaga alles, wovor China Angst hat».

Bei einem von Lady Gaga gesponserten Festival gab es einen «Artpop»-Moment, bei dem sich ein «Kotzkünstler» auf die Sängerin erbrochen hat.
«Für uns war diese Performance Kunst in ihrer reinsten Form. Aber wir verstehen vollkommen, dass manche Leute das nicht mögen», erklärte Gaga.
Dazu gehören wahrscheinlich mehr als eine Milliarde Chinesen, die von amerikanischer Kotzkunst nicht viel halten und keinen Grund sehen, dieser Künstlerin nachzueifern. Natürlich wird in China auch ausländische Musik gehört, wie K-Pop oder die Musik von Taylor Swift, Ed Sheeran, Shawn Mendes, Drake, Coldplay und Passenger, aber meist von eher jüngeren Menschen. Es gibt sogar eine Fernsehsendung namens «中国有嘻哈», was wörtlich bedeutet: «China hat Hip-Hop». Natürlich erfährt man davon nichts in den westlichen Medien, die China lieber verunglimpfen.

Trendige Videos über Strassenmode in China auf Douyin, der chinesischen Version von Tik Tok, widersprechen der westlichen Medienpropaganda, die das Land als eher trist, farblos und als «kollektivistische Diktatur» darstellt. Wer mehr über China erfahren möchte, und zwar nicht durch die westlich getrübte Linse, kann dies auf diesem von Expats in Hongkong betriebenen Portal tun.
Fortsetzung folgt.