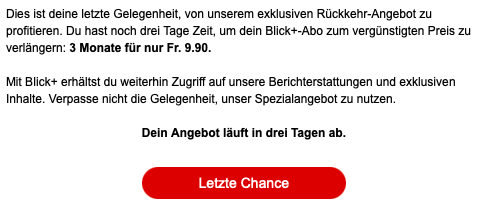Ein grauenvolles Jahr
Tiefseebohrung. Das beschreibt den Zustand der Schweizer Medien im Jahr 2023.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Dass nach der Entlassungsrunde vor der Entlassungsrunde ist, daran mussten sich die verbliebenen angestellten Redakteure gewöhnen. Die grossen Verlagshäuser Tamedia, CH Media und Ringier zeigen damit den überlebenden Journalisten, was sie von ihnen halten: nichts.
Sie sind ein unangenehmer Kostenfaktor, bis die KI die meisten ihrer Aufgaben übernimmt. Den gutbezahlten Managern in der Teppichetage ist auch 2023 nur ein einziges Heilmittel gegen die Arglist der Zeit eingefallen: sparen, feuern, letzte Fleischreste vom Knochen abschaben. Das ist erbärmlich.
Allerdings tun auch die Journalisten nicht gerade viel, um die wichtigsten Assets, Glaubwürdigkeit und Vertrauen, zu schützen und zu bewahren. Nabelschau, kreischige Rechthaberei, Bedienung der Gesinnungsblase, Schwarzweiss-Verblödung. Wer dachte, man sei noch nie so schlecht über einen Krieg informiert gewesen wie in der Ukraine, sah sich eines Schlechteren belehrt. Was im Gazastreifen tatsächlich passiert, niemand weiss Genaueres.
In beiden Fällen versagt die Journaille auf einem ihrer wichtigsten Handlungsfelder: analytische Einordnung liefern, Argumente zur Bildung einer eigenen Meinung bei den Lesern. Da vielfach ältere und damit teurere Journalisten weggespart werden, sinkt das allgemeine Niveau der Berichterstattung auf erschreckend bildungs- und kulturlose Minusgrade. Historische Zusammenhänge, Kenntnis von Kultur und Literatur, was nicht im schnellen Zugriff mit Google aufpoppt, existiert nicht.
Wenn die Sprachverbrecher Lukas Bärfuss und Kim de l’Horizon als die zwei bedeutendsten Vertreter der Schweizer Gegenwartsliteratur angesehen werden, dann ist wohl der Boden der Geschmacklosigkeit erreicht. Wobei man mit solchen Vermutungen vorsichtig sein sollte. Bevor Kim auftauchte, meinte man den mit Bärfuss alleine schon ausgelotet.
Wer meinte, die Sprachreinigungshysterie, die Verhunzung der deutschen Sprache durch Gender-Sternchen und andere Methoden zur angeblichen Inkludierung habe einen dermassen hysterischen Höhepunkt erreicht, dass es nur noch vernünftiger werden könne, sah sich ein weiteres Mal getäuscht. Das gilt auch für alle Post-#metoo-Schwurbeleien.
Unbelegte Anschuldigungen öffentlichkeitsgeiler Weiber oder anonymer Denunzianten reichten auch 2023 aus, um Karrieren zu vernichten oder Menschen fertigzumachen. Trotz vielen Flops haben die Scharfrichter in den Medien nichts dazugelernt. Schnelle Vorverurteilung, grosse Entrüstung, dann peinlich berührtes Schweigen, wenn der Skandal mal wieder keiner war. Aber auf zum nächsten, der kommt bestimmt.
Auch als Jahresbilanz muss man festhalten: Dass sich die Medienproduzenten weiterhin von Google, Facebook & Co. online die Werbebutter vom Brot nehmen lassen, ist an Unfähigkeit und Dummheit nicht zu übertreffen. Das Gejammer über wegfallende Print-Inserate und der anhaltende Ruf nach staatlicher Unterstützung der Vierten Gewalt sollen nur übertönen, dass die Krise der Medien nicht den Umständen geschuldet ist, sondern selbstverschuldet.
Kein vernünftiges Distributionsmodell, das aberwitzige Geschäftsmodell, für immer weniger immer mehr zu verlangen, seichte Inhalte, sich im Hamsterrad der Online-Produktion bis zur Bewusstlosigkeit drehende News-Abdecker – wie kann man für diese klägliche Leistung ernsthaft Geld vom Konsumenten verlangen?
Geradezu autistisch richten viele Redakteure ihren Blick an diesen Problemen vorbei, schauen in sich hinein und langweilen den Leser mit der Leere, der sie dort begegnen. Oder regen ihn auf, indem sie ihre politischen und sozialen Steckenpferde auf offener Bühne zu Tode reiten. Ein Kommentar zur Gratis-Abgabe von Tampons, wieso traut sich keiner mehr, die einzig richtige Antwort an der Themenkonferenz zu geben: «Aber nicht im Ernst?»
In diesem Niedergang wird das Schweizer Farbfernsehen, die mit Gebühren alimentierten Radiosender immer wichtiger. Aber das Angebot der SRG ist dermassen lausig, dass die 200-Franken-Gebühreninitiative intakte Chancen hat. Auch hier ist es den privaten Unternehmen nicht gelungen, eine valable Konkurrenz dazu auf die Beine zu stellen. Das sei eben die Übermacht der SRG, jammert der Wannerclan von CH Media. Anstatt zuzugeben, dass die Einkaufstour in den elektronischen und Printmedien als deutlichstes Resultat lediglich eine Massenentlassung gebracht hat.
Völlig von der Rolle sind Tamedia und Ringier. Der Tagi war einmal eine ernstzunehmende, linksliberale Stimme, seine Leitartikel und Forderungen hatten Gewicht. Aber heute? Das nimmt doch keiner mehr ernst, wenn sich die Oberchefredaktorin zu Wort meldet und absurde Forderungen zu den nächsten Bundesratswahlen aufstellt.
Der «Blick» als wichtigstes Organ des Hauses Ringier wurde seines Wesenskerns beraubt, die Führungsriege geköpft, dafür ein Rudel von Heads und Chiefs installiert, deren Funktionsbezeichnungen kabarettreif sind. Weniger lustig sind allerdings ihre Leistungen. Springer zieht weiter in die Zukunft und trennt sich konsequent von seinen Printtiteln. Ringier kauft sie auf. Mathias Döpfner mag persönlich ein eher unausstehlicher Mensch sein, was er mit Marc Walder gemein hat. Aber der Unterschied im Wirken und in der Performance der beiden an ihren Unternehmen beteiligten CEOs ist unübersehbar.
Ach, und die NZZ? Ein Leuchtturm mit einigen blinden Flecken auf der Linse, das Bild ist schwer zu schlagen, so zutreffend ist es. Häufig Labsal und Kopfnahrung, manchmal aber auch ärgerliche Ausflüge ins Unterholz der vorgefassten Meinungen und neuerdings auch üblen Rempeleien in einer Tonlage, die die alte Tante seit Ende des Kalten Kriegs nicht mehr verwendete.
Auch der ruppige Umgang mit Chefredaktoren ist neu. War die Absetzung von Markus Spillmann zwar ein absolutes Novum, aber dennoch gerechtfertigt, wurde die Absetzung von Luzi Bernet und sein Ersatz durch Jonas Projer eher ruppig durchgeführt. Das war aber noch geradezu stilvoll und zartbesaitet im Vergleich dazu, wie dann Projer entsorgt wurde.
Dabei, wie bei der Nicht-Inauguration von Markus Somm als NZZ-Chefredaktor, spielte die Redaktion eine üble Rolle. Bei Somm stellte sich im Nachhinein heraus – als er mit der Absurd-Idee, aus dem «Nebelspalter» ein bürgerlich konservatives Kampforgan zu machen, baden ging –, dass der NZZ doch einiges erspart blieb. Aber der Zwergenaufstand in der Redaktion gegen Projer führte nur erwartungsgemäss dazu, dass die NZZaS viel näher an das Stammblatt gebunden wurde. Der notfallmässig installierte Beat Balzli ist noch viel mehr von der Gnade Eric Gujers abhängig als sein Vorgänger.
Allerhand Betrübliches und Besorgniserregendes ist von den Medien im Jahr 2023 zu vermelden. Gibt es Hoffnung für 2024? Für die klassische Medien nicht. Vor allem bei Jugendlichen haben sie längst die Meinungshoheit als Newslieferant verloren. Wenn der Bezahl-Inhalt qualitativ sich kaum von Gratis-Angeboten unterscheidet, wieso soll ein vernünftiger Mensch noch etwas bezahlen?
Natürlich sollte der Content einer Newsplattform nicht gratis sein. Eine Bezahlschranke macht aber nur dann Sinn, wenn dieser Inhalt auch etwas wert ist. «Blick+» ist das beste Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Die Idee wurde bei «Bild+» abgekupfert, aber jämmerlich umgesetzt. Tamedia macht ähnlichen Unsinn, indem es beim Berliner «Tagesspiegel» die Idee übernimmt, sauteure Angebote für spezifische Zielgruppen zu machen. Wer einen fantasielosen Verwaltungsrat mit einer digitalen Offensive betraut, der sich dann an seine frühere Wirkungsstätte erinnert, ist selber schuld.
Nein, das ist kein Aufsteller,diese Jahresbilanz. Aber zum Jammertal, durch das der Journalismus wankt, passt eben auch, dass solche offenen Worte nurmehr hier auf ZACKBUM möglich sind.
Für das anhaltende Leserinteresse, liebe Worte (immer hinter vorgehaltener Hand) und auch (wenige) Widerworte danken wir ganz herzlich.