Die Macht der Worte
Entscheidungen fallen mündlich. Ein unterschätztes Phänomen.
Das Regierungshandwerk stellen sich viele völlig falsch vor. Wenn sich der Laie fragt, wie denn eigentlich eine gewichtige Entscheidung zustande kommt, nimmt er an, dass gewaltige Räderwerke in Marsch gesetzt werden.
Es werde analysiert, recherchiert, Arbeitsgruppen verfassen Papers, Entscheidungsgrundlagen, lange Listen von Argumenten dafür und dagegen, die rechtlichen Rahmenbedingungen werden abgeklärt, historische Vergleiche gesucht, Q&A verfasst, Gutachten erstellt, schliesslich wird das Ganze eingedampft und als Entscheidungsgrundlage eingereicht.
Daraufhin beugt sich der Regierende darüber, studiert die Texte, macht da und dort mit grüner Cheftinte Anmerkungen, stellt ein Exzerpt her, ringt mit sich, verbringt eine schlaflose Nacht – und kommt zu einer Entscheidung.
Es ist möglich, dass ganz, ganz, ganz selten eine Entscheidung so zustande kommt. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus.
Andere Faktoren spielen eine entscheidende Rolle
In Krisensituationen spielen Überforderung, Unsicherheit und Schlafmangel eine bedeutende Rolle. Wer das nicht glaubt, lese das ausgezeichnete Buch «Die Schlafwandler» von Christopher Clark. Der Historiker beschreibt eindrücklich, wie wichtig diese Faktoren für den Beginn des Ersten Weltkriegs waren.
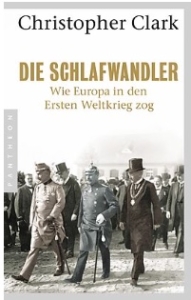
Oder wie das Karl Kraus 1914 formulierte, eine Zeit, «in der eben das geschieht, was man sich nicht vorstellen konnte, und in der geschehen muss, was man sich schon nicht mehr vorstellen kann, und könnte man es, es geschähe nicht».
Ein zweiter wichtiger Faktor beim Treffen von Entscheidungen: die Unfähigkeit, sich die Konsequenzen vorzustellen. Das Nichtwissen, welche Auswirkungen eine Entscheidung haben kann.
Auf Netflix läuft eine dramatisierte Darstellung der Ereignisse rund um die Müncher Konferenz von 1938. Das basiert auf dem Buch von Richard Harris «München». Nicht sein bester Thriller, aber er dramatisiert die Ereignisse um den vergeblichen Versuch des britischen Premiers Neville Chamberlain, durch Opferung eines Stücks der Tschechoslowakei den Kriegsausbruch zu verhindern.
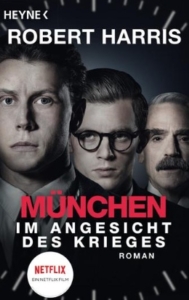
Nach seiner Rückkehr hielt Chamberlain eine kurze Rede, in der er über den «peace for our time» schwärmte, das Abkommen sei der erste Schritt in eine friedliche Zukunft. Rund ein Jahr später begann der Zweite Weltkrieg.
Entscheidend ist das Wort. Das gesprochene
Der dritte, wichtigste Faktor bei einer Entscheidungsfindung ist aber das Wort. Genauer: der mündliche Vortrag. Wer in einer Debatte das schlagende Argument aus dem Hut zaubert, wer alle Einwände niederbügelt, wer schlagfertig ist, auch nach stundenlangem Geraufe hellwach und schnell mit Antworten zur Hand, der gewinnt.
Ist es eine streng hierarchische Veranstaltung, singt natürlich immer der Häuptling am schönsten. Seine Lakaien versuchen zu erahnen, welche Absicht der Herrscher wohl hat, welche Ansicht er vertritt. Und reden ihm dann nach dem Mund.
Häufig ist es aber so, dass im vertraulichen Kreis der Entscheider zunächst im offenen Schlagabtausch herausfinden will, was vielleicht die beste Entscheidung wäre. Und da gewinnt dann meist nicht das beste, zweckrationale, überlegene, weise, richtige Argument, sondern das am besten vorgetragene.
Alles Geraschel mit Papieren, Executive Summarys, Pro und Cons, Entscheidungsbäumen, Herleitungen: unnütz. Der bessere Rhetoriker gewinnt. Immer. In der Neuzeit konnte man das Phänomen zum ersten Mal in den Versammlungen nach der Französischen Revolution beobachten.
Da gab es ganz verschiedene Temperamente unter den Rednern. Die unerbittliche Kühle eines St. Just. Die gewaltige intellektuelle Überlegenheit eines Marat. Die schon körperlich sich manifestierende Urgewalt eines Danton. Und die schneidende, unerbittliche Logik eines Robbespierre. Der aussah wie ein schmächtiger Buchhalter, der gebückt und ohne grosse Stimmkraft seine Argumente vortrug. Damit aber alle anderen in den Schatten stellte. Schon fast entscheidungsreife Überzeugungen mit einer einzigen Rede umwarf.
Das Zünglein an der Waage spielte, als es darum ging, ob man den König hinrichten sollte oder nicht. Man war eher für nicht, bis Robbespierre seine Rede hielt. Daraufhin verrichtete die Guillotine ihr Werk; eine zeitgenössische Darstellung erlangte jüngst wieder unrühmliche Bekanntheit, als geschmacklose Dummsatiriker in sie den Kopf einer missliebigen Journalistin hineinkopierten.
Diese gewaltige Macht des Wortes beschreibt Hilary Mankel in ihrem Gewaltsroman «Brüder» über die Französische Revolution. 1100 Seiten, deren Lektüre sich unbedingt lohnt.
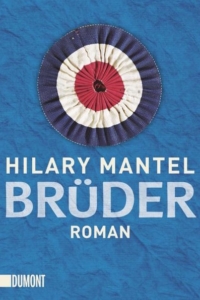
Bis heute ist es so, dass alle Wordings, alle ausgetüftelten Kampagnen, alle klug gewählten Keywords das eine sind. Das andere, wichtigere ist aber der Sieg in der offenen Feldschlacht, in der Debatte. Auch da kann mit vorbereiteten Zeilen gearbeitet werden. Es hängt aber vom Geschick des Redners ab, wann und ob er sie zum Einsatz bringt.
Seltene Sternstunden heutzutage
Leider entstehen solche Sternstunden immer seltener, und meistens ausserhalb des parlamentarischen Betriebs. Dort verkommen die Wortmeldungen immer mehr zu Pflichtübungen, da die Meinungen schon vorher gemacht sind und sich auch nicht mehr durch noch so überzeugende rhetorische Leistungen umstürzen lassen.
Aber im kleinen Kreis, beispielsweise im Bundesratszimmer, da kommt es wieder sehr darauf an, wie überzeugend jemand vorträgt. Auch da wird ein SP-Genossen eigentlich niemals einem Vorschlag des SVP-Bundesrats zustimmen. Aber manchmal, manchmal dann doch. Weil mal wieder die Macht des Wortes triumphiert hat.
