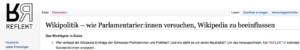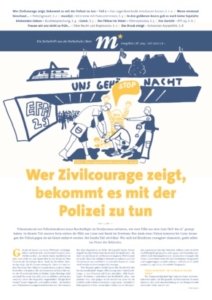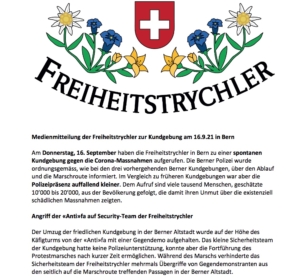Korrupter Selenskyj
Die NZZ ist mal wieder vorbildlich. Bis zu einem gewissen Grad.
Die Ukraine ist eines der korruptesten Länder der Welt. Immer wieder werden Vorwürfe erhoben, dass gewichtige Teile westlicher Hilfsgelder versickern, abgezweigt werden, in den Taschen der Kamarilla um Präsident Selenskyj landen.
Auch er selbst steht unter Korruptionsverdacht, ihm wird ein Millionen-, ja Milliardenvermögen nachgesagt. Stimmt das? Ist der Präsident der Ukraine reich, sehr reich? Dieser Frage geht die NZZ verdienstvoll in einem Videocast nach. Sie macht das, worauf andere Medien mangels Masse, Willen oder Fähigkeit zunehmend verzichten. Das wäre eine Aufgabe wie massgeschneidert für das grossartige «Recherchedesk» von Tamedia gewesen. Aber das schnarcht vor sich hin, wenn es sich nicht an der Ausschlachtung von Hehlerware – gestohlenen Geschäftsunterlagen – beteiligen kann.
Im Gegensatz dazu haben Florentin Erb und Jasmine Jacot-Descombes den Versuch unternommen, Behauptungen und Gerüchten über die Vermögensverhältnisse von Selenskyj nachzugehen und sie zu verifizieren oder zu falsifizieren. Eigentlich braucht es dazu nicht mehr als solides journalistisches Handwerk. Schliesslich gibt es Selbstdeklarationen, Grundbuchämter, Bildersuche bei Google und die Nachprüfbarkeit der Echtheit von Dokumenten wie Kaufverträgen oder Quittungen.
Bei ihren Recherchen kommen die beiden NZZ-Journalisten auf ein Gesamtvermögen Selenskyjs von rund 12 Millionen Dollar. Besonders erwähnenswert ist dabei, dass eine 4,6-Millionen-Villa in Italien bis 2019, also vor den Präsidentschaftswahlen, in seinen Erklärungen auftaucht, dann aber verschwand. Wobei es allerdings nachweisbar ist, dass sie sich über Tarnfirmen immer noch im Besitz des Präsidentschaftspaares befindet.
Verdienstvoll ist auch, dass die NZZ diverse Behauptungen auf Social Media, dass dem ukrainischen Präsidenten eine Yacht und Villa in Florida, ein Konto in Costa Rica oder gar die ehemalige Villa von Goebbels in Berlin gehören sollen, als Fake News entlarvt.
Tapfer zitieren sie auch Schätzungen von «Forbes», dass der Präsident ein Privatvermögen von bis zu 30 Millionen Dollar angehäuft haben soll.
Aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Ein Schatten ist, dass die «Leiterin des Themenbereichs Wirtschaftskriminalistik» an der Uni Luzern ihrem Ruf nicht gerade beförderlich ist. In eingespielten Aussagen beschönigt sie die Verwendung von Trust, Holdings und anderen Tarnfirmen, die Selenskyj gehören, als durchaus legitimen Schutz von Vermögenswerten. Ob Claudia V. Brunner auch so nachsichtig wäre, wenn es sich um die Untersuchung der Reichtümer eines russischen Oligarchen handelte?
Einen zweiten Schattenwurf liefert die NZZ, indem sie behauptet, das seien vielfach höchstwahrscheinlich von Moskau gestreute Desinformationen zur Diskreditierung des ukrainischen Präsidenten und um eine Stimmung zu schüren, die gegen die weitere Unterstützung des korrupten Staates sei.
Dafür führen die NZZ-Journalisten ein Quote eines US-Politikers an, der die Falschmeldung über eine Selenskyj-Yacht aufnehme, um gegen weitere US-Hilfsgelder zu wettern. Allerdings unterschlagen sie dabei, dass der Politiker davon spricht, dass sich ein Selenskyj-Minister mit diesen Geldern eine Yacht kaufen könne. Auch nicht so die feine Art, wenn man schon gegen Fake News stänkert.
Der grösste Schatten in der Reportage liegt aber auf dem Thema, wer denn eigentlich den damaligen Wahlkampf von Selenskyj finanziert hat, wer ihn damals beriet, wer aus einem politisch unbedarften Komiker in kürzester Zeit einen versierten Politiker machte, wer sein Image schärfte und ihn zu einem Erdrutschsieg aus dem Nichts führte.
Da fällt immer der Name Ihor Kolomojskyj. Das ist einer der reichsten ukrainischen Oligarchen mit einem geschätzten Vermögen von einigen Milliarden Dollar. Er war bis zu seiner Zwangsabsetzung Gouverneur einer Provinz und Besitzer der PrivatBank und der Privatbank-Gruppe. Er finanzierte den Aufbau der faschistischen Asow-Bataillone. Er ist der Mitbesitzer einer TV-Produktionsfirma, an der auch Selenskyj beteiligt ist. Die ihren Sitz, was Brunner sicher völlig in Ordnung fände, als Holding auf einer kleinen Insel hat und deshalb auch in den Panama-Papers auftaucht.
Zu seinem Vermögen kam er, typisch für solche Oligarchen, mit – höflich formuliert – hemdsärmelig dubiosen Methoden. Zitieren wir aus Wikipedia:
«2020 ernannte ihn das internationale Zentrum für die Erforschung der Korruption und des organisierten Verbrechens zu einem der vier korruptesten Amtsträger des Jahres. Kolomojskyj habe eine „Geschichte von Unternehmensrazzien, Betrug, Unterschlagung und politischen Intrigen“ und vertrete „viele ideologische und korrupte Milliardäre, von den Koch-Brüdern bis zu Arron Banks, die die Demokratie zum persönlichen Vorteil untergraben haben“.»
Nachdem die PrivatBank verstaatlicht werden musste, da aus ihrer Bilanz 5 Milliarden Dollar verschwunden waren, die der Oligarch wohl auf solchen harmlosen Tarnkonstrukten wie Trusts und Holdings auf kleinen Inseln versteckt hatte und nachdem diverse Strafverfahren gegen ihn eröffnet wurden, zog sich der Oligarch sicherheitshalber für eine Weile nach Israel zurück.
Um nach dem Wahlsieg Selenskyjs wieder in Kiew Wohnsitz zu nehmen; geschützt durch eine Amnestie des neuen Präsidenten. Allerdings wanderte Kolomojskyj im September 2023 für zwei Monate in «Gewahrsam», um in Ruhe Vorwürfe von Geldwäsche und Betrug untersuchen zu können. Offenbar ist an seiner Männerfreundschaft mit dem ukrainischen Präsidenten etwas zerbrochen.
Diese Korruptionsthematik zu untersuchen, das sprengte wohl das Format – oder die Fähigkeiten – der beiden NZZ-Journalisten.
Aber immerhin, so eine Recherche ragt dennoch wie ein Leuchtturm über das oberflächliche Gewäffel der Konkurrenz hinaus.