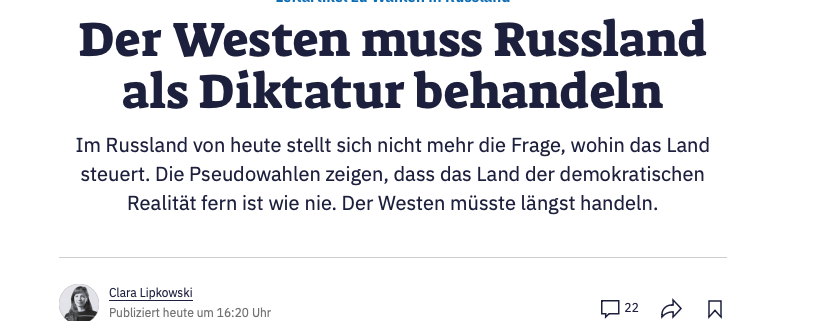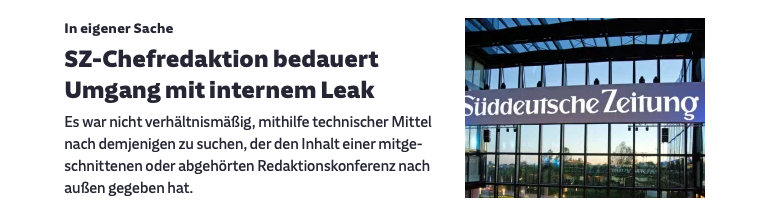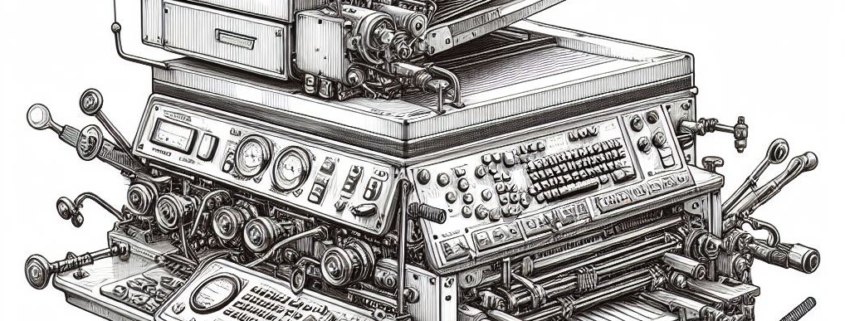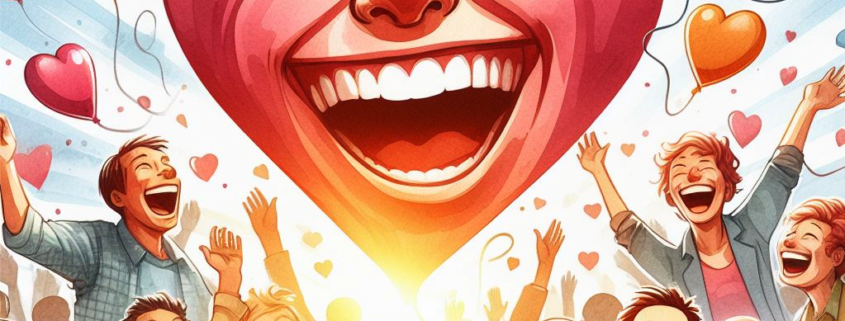Multitasking
Woher Tamedia seine Meinung übernimmt.
Es ist ein anhaltender Skandal, dass einer der wenigen überlebenden Medienkonzerne der Schweiz seine Meinung aus München übernimmt und sie seinen zahlenden Schweizer Lesern als Eigenleistung präsentiert. Man kann hier sogar von einem Etikettenschwindel sprechen.
Denn Clara Lipkowski wird dem Tamedia-Leser serviert als «Redaktorin im Ressort International mit Schwerpunkt Ukraine und Russland». Die Wahrheit ist, dass sie nach einem Volontariat «freie Mitarbeiterin» der «Süddeutschen Zeitung» ist, «seit August 2020 Korrespondentin für Franken». All das qualifiziert sie ungemein, neben Artikeln über das Wachsen Nürnbergs, über «Warum es an Bayerns Flughäfen zu Reiseausfällen kommt» oder «Eltern tun alles, um einen Kita-Platz zu finden» einen Kommentar über die russischen Wahlen abzusondern.
Ein Kommentar, den die SZ selbst (bislang) nicht für veröffentlichungswürdig hält. Anscheinend funktioniert dort noch eine gewisse Qualitätskontrolle. Aber bei Tamedia mausert er sich zum «Leitartikel». Das Wort bedeutete früher mal was.
Aus ihrer sicheren Schreibstube rechnet Lipkowski mit Präsident Putin ab: «Seine Macht kennt kaum Grenzen. Er räumt aus dem Weg, wer ihm gefährlich wird. Alexei Nawalny musste deshalb sterben. Putin steuert die Medien, er personifiziert die Alternativlosigkeit, neben ihm gibt es keinen Platz.»
Die Wahlen in Russland seien eine Farce, erklärt sie überraschungsfrei. Dann aber wagt sie einen Blick in die Zukunft: «Wie kann Russland zurückfinden zu einer russischen Demokratie?» Zurückfinden, Demokratie? Wann gab’s denn das? Unter den Zaren? Unter Lenin? Unter Stalin? Unter Gorbatschow? Unter Jelzin? Hat die Dame neben Kenntnissen über Franken auch nur den Hauch einer Ahnung von Russland?
Aber auf jeden Fall weiss sie, was in Russland geschehen sollte:
«Die Eliten sind es, die Putin die Gefolgschaft verwehren müssten. Sicherheitskräfte, auch die Putin unterstellte Nationalgarde, müssten Befehle ignorieren, die Waffen niederlegen. Staatsbedienstete dem Staat den Dienst verweigern. Kremltreue Konzernchefs Putin den Rücken kehren. Erst so kann das System von innen beginnen zu bröckeln.»
Fränkisches Wolkenkuckucksheim. Aber sie schwebt noch höher in Illusionswolken: wie soll der Westen mit den Wahlen umgehen? «Ein Weg wäre es, sie und damit Putin als Präsident nicht anzuerkennen. So wie es der Westen 2020 im Fall von Alexander Lukaschenko getan hat.»
Das empfiehlt sie allen Ernstes EU-Politikern; für zwei hat sie noch einen weiteren Ratschlag zur Hand: «Wirkung hätte dieser Schritt wohl nur, wenn der Westen geeint agiert. Wenn Leute wie der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Kanzler Olaf Scholz aufhören würden, sich in öffentlich ausgetragenen Streitereien um europäische Bodentruppen oder Marschflugkörper in der Ukraine zu zerreiben.»
Sagen wir so: In der SZ existieren offenbar noch Spurenelemente einer Qualitätskontrolle, wo man sogar einer Autorin (!) zu sagen wagt: schreib lieber etwas über Franken, davon verstehst du vielleicht was.
Aber Tamedia weiss weder, wo Franken liegt, noch, was man dem Leser nicht zumuten sollte. Statt ständig Rochaden in der Teppichetage vorzunehmen. Mathias Müller, vulgo von Blumencron, beendet seine Tätigkeit als «publizistischer Leiter». Woran man das merkt? Gute Frage. An seiner Stelle rauscht nun Simon Bärtschi an seiner Chefin Raphaela Birrer vorbei. Zuvor war er ihr Untergebener als Chef «Berner Zeitung» und «Bund». Dort erwies er sich als gehorsamer Terminator, als Tamedia das heilige Versprechen brach, dass niemals nie «BZ» und «Bund» verschmolzen würden. Und nun ist er als neuer «publizistischer Leiter» Birrers Vorgesetzter.
Sein gröbstes Problem dabei: er ist (soweit ZACKBUM bekannt) ein Pimmelträger. Und keine Quotenfrau. Wo bleibt da der versprochene Anteil von mindestens 40 Prozent Frauen (trans, hybrid, fluid, queer, notbinär, Pardon, nonbinär ist leider nicht berücksichtigt)? ZACKBUM will sich keinesfalls in den Intimbereich Bärtschis einmischen. Aber das offizielle Macho-Foto mit männlich-bestimmtem Blick und Dreitagebart, muss das sein? Da erwarten wir wenigstens etwas weibliche Sanftheit. Sonst gibt’s dann mal wieder ein Protestschreiben …

zVg Tamedia