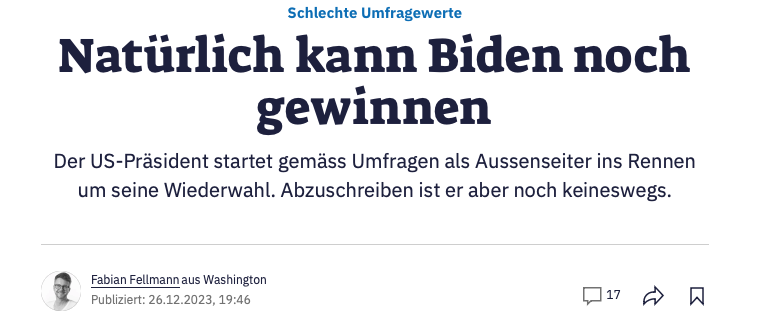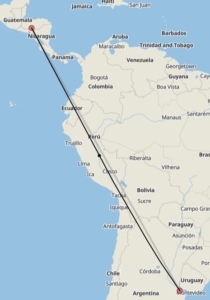Pfeifen im Wald
Wie peinlich kann Tamedia noch werden?
Offensichtlich aus dem letzten Mal nichts gelernt. Bekanntlich waren sich (fast) alle Kommentatoren, USA-Kenner, Analysten und grossen Wahlstrategen bis zum November 2016 sicher und einig: wir haben die erste Präsidentin der USA, völlig klar, dass dieser Amok mit merkwürdiger Frisur niemals gewinnen kann, ausgeschlossen.
Dann gab es eine schreckerfüllte, kurze Sendepause. Anschliessend musste erklärt werden, wieso die Wahl Trumps das Ende der Menschheit einläutet, diejenigen, die ihn gewählt haben, bescheuert sind, und dann kam Relotius. Gleichzeitig machte sich das ehemalig angesehene Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» mit der Ankündigung lächerlich, als vornehmste Aufgabe und Pflicht anzusehen, Trump «wegzuschreiben».
Dann kam Biden, allgemeines Aufatmen. Aber nun zeichnen sich die nächsten Wahlen in gut 10 Monaten am Horizont ab, und es droht, was all den Trump-Hassern wieder den Angstschweiss den Rücken runterfliessen lässt. Es sieht ganz danach aus, als ob Trump wieder antreten würde, falls ihn eines der vielen Gerichtsverfahren nicht stoppt. Und es sieht ganz danach aus, als ob Biden wieder antreten würde, falls seine senilen Aussetzer nicht ein Ausmass annehmen, dass er notfallmässig ersetzt werden müsste. Die dafür vorgesehene Vizepräsidentin hat sich – ebenso wie Biden – als Flop erwiesen und kommt nicht in Frage.
Üble Ausgangslage, vor allem für die Amis. und natürlich für die Kommentatoren. Schon recht früh macht sich einer bereits nach Kräften lächerlich: «Natürlich kann Biden noch gewinnen», spricht sich und seinen Gesinnungsblasenlesern Fabian Fellmann Mut zu. Man konstatiert hier eine zunehmende Konvergenz zwischen «Republik» und «Tages-Anzeiger». Wenn die Wirklichkeit nicht ins ideologisch gefärbte Bild von ihr passt, dann wird sie passend gemacht.
Denn die Wirklichkeit ist dramatisch: «Biden zieht beinahe schon als Aussenseiter in die Wiederwahl gegen den Möchtegern-Diktator Donald Trump.» «Beinahe schon» und «Möchtegern-Diktator» eigentlich könnte man hier schon aufhören, den Quatsch zu lesen. Wer’s nicht tut: da gebe es, Schauder, Schauder, Umfragen, die eine Führung Trumps ergeben. Aber gemach: «Der angebliche Vorsprung von Trump, der seit Monaten Schlagzeilen macht, schrumpft bei genauerer Betrachtung zusammen.»
Man meint, das kollektive Aufatmen der verbleibenden Tagi-Leser zu hören. Aber Fellmann ist mit seiner Demontage der Umfragen noch nicht fertig: «Meistens führt Trump mit Werten, die sich lediglich im statistischen Fehlerbereich bewegen, was bedeutet, dass die beiden Männer in etwa gleichauf liegen. Ausserdem dürfte mindestens ein Drittel der Wahlberechtigten an der Wahl gar nicht teilnehmen.»
Einer geht dann noch: «Zehn Monate vor dem Wahltermin haben solche Umfragen beschränkte Aussagekraft über die wahren Stimmabsichten.»
Also doch kein Anlass zur Panik? Fellmann versteht sich auf ein Wechselbad der Gefühle: «Es soll kein zu rosiges Bild entstehen. Allein die Tatsache, dass Trump Biden derart in Bedrängnis zu bringen vermag, ist ein Alarmsignal.» Was für ein Alarmsignal? Dass der Amtsinhaber, von Anfang an eine Verlegenheitslösung, weil die Personaldecke der Demokraten nicht weniger dünn ist als die der Republikaner, kaum etwas gebacken gekriegt hat, in Umfragen über die Zufriedenheit mit seiner Amtsführung abschmiert, immer wieder zeigt, dass er körperlich und mental so stark abbaut, dass man sich ernsthaft Sorgen um seine Fähigkeit, Kontakt mit der Realität zu halten und eigenständige Entscheidungen zu treffen machen muss, das sind Alarmsignale.
Dass ein Amok wie Trump ihn tatsächlich bei den kommenden Wahlen gefährden kann, ist ein Alarmsignal, aber anders, als Fellmann meint. Nicht wegen Trump, sondern wegen Biden. Aussenpolitisch rudert er herum, innenpolitisch gibt es kaum Lebenszeichen von ihm; sollte noch die Wirtschaft in eine Rezession geraten, dürften die Chancen auf Wiederwahl weit unter 50 Prozent fallen.
«Kann» er noch gewinnen? Natürlich. Es kann auch ein Meteorit einschlagen, Trump kann durch sein Haarfärbemittel vergiftet werden, es könnten auch Aliens landen und die Wahlen absagen. All das «kann» passieren.
Das ist alles Vermutungs-Konjunktiv, das Dreschen von leerem Stroh. Damit kann man sich lächerlich machen. Damit macht sich Fellmann lächerlich. Wozu Tamedia («Seit Sommer 2021 berichtet der Politologe als USA-Korrespondent aus Washington, D.C») so jemanden beschäftigt (und bezahlt!), das fragt sich der gebeutelte Leser. Der kann sein Abo verlängern. Oder auch nicht, weil er sich fragen könnte: wieso soll ich für dieses Gebabbel etwas bezahlen? Das ist doch wertlos, wieso sollte es dann geldwert sein?