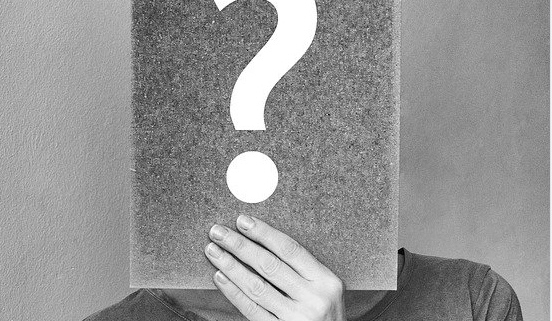Der hinterhältige Bucheli
Die Meinungskrieger sind am Werk.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Roman Bucheli ist eigentlich für deutschsprachige Literatur «sowie für das Kinder- und Jugendbuch» zuständig. Also eine idyllische Tätigkeit für den studierten Germanisten und Philosophen.
Das hindert ihn aber nicht daran, sich in die garstigen Niederungen der Konfliktberichterstattung zu begeben. Obwohl sein Vordenker Peter Rásonyi bereits genügend vorgelegt hat, ist Bucheli wohl der Meinung, dass doppelt polemisiert wohl besser halte. Also legt er unter dem Titel «Das hinterhältige Aber» ein intellektuelles Schmierenstück vor, das überhaupt nichts Kindliches und auch nichts Kindisches hat. Ausser vielleicht beim Argumentationsniveau.
Zunächst zitiert er einige Prominente, die sich kritisch über die Reaktion Israels auf den barbarischen Angriff der Hamas geäussert haben. Jedesmal fragt er in Anklägermodus: «Wo waren die am 7. Oktober?» Eine hübsche rhetorische Pirouette, die unterstellt, dass alle, die Israel kritisieren, den Terrorschlag der Hamas ausblenden würden. Was sie natürlich nicht tun. Aber Unterstellungsjournalismus statt inhaltliche Auseinandersetzung ist en vogue, leider auch in der NZZ.
Das ist nur die Einleitung, um richtig Gas zu geben. Er nimmt sich den Satz vom luftleeren Raum des UN-Generalsekretärs nochmals zur Brust, obwohl in normalen Zeiten die Qualitätskontrolle sagen würde: hatten wir alles schon, wozu die Wiederholung?
Nun, damit auch Bucheli noch seinen Senf dazu geben kann: «Was hatte er also damit sagen wollen? Dass die Hamas Grund zum Morden hatte? Weil sie die Luft atmeten, in der die Israeli den Hass gesät haben sollen? Wer so denkt, vergisst oder verschweigt, was in der Charta der Hamas steht.»
Aber das alles ist nur eine längliche, aufgepumpte Einleitung zu dieser Infamie:
«Man merkt schon, wohin die Leute zielen, wenn sie solche verbalen Pirouetten drehen. Das Massaker der Hamas wird verharmlost oder gleich ungeschehen gemacht, indem es aus dem Gedächtnis gelöscht wird. Es erforderte keine besondere prophetische Gabe, um schon am Morgen nach dem 7. Oktober voraussagen zu können, dass Israel für das Massaker würde büssen müssen. Es würde dafür bestraft werden, das Opfer einer schändlichen Bluttat geworden zu sein.»
Wer will das Massaker der Hamas ungeschehen machen? Wer will die Israelis dafür bestrafen, Opfer geworden zu sein? Die US-Schauspielerin Tilda Swinton, mitsamt 2000 Künstlern Autorin eines Protestbriefs? Da ist Bucheli jede Unredlichkeit recht, denn er zitiert sehr ausgewählt aus diesem Protestschreiben und unterschlägt zum Beispiel, dass im Brief «jede Gewalttat gegen Zivilisten und jede Verletzung des Völkerrechts, wer auch immer sie begeht» verurteilt wird. Das Schreiben zitiert auch den israelischen Verteidigungsminister Yoav Galant, der die Palästinenser als «menschliche Tiere» abqualifiziert.
Wenn man diesen eines Verteidigungsminister eines zivilisierten Staates unwürdigen Satz kritisiert, muss man dann zuerst auf die Charta der Hamas hinweisen, die die Vernichtung Israels als Ziel formuliert? Muss man zuerst seinen Abscheu über die Bluttaten der Hamas äussern? Und muss man das alles in Worten und in einer Art tun, die Bucheli akzeptieren kann? Wo sind wir hier eigentlich?
Ist das ein Niveau der Schmiere, das der NZZ angemessen ist? Eigentlich nicht. Aber Bucheli ist sich sicher: «Die vereinigten Antisemiten der Welt würden grossen Zulauf erhalten». Dann nimmt sich Bucheli sogar noch Daniel Binswanger von der «Republik» vor. Dessen dilettantischer Kommentar unter dem Titel «Wir sind alle Israelis» enthält für Bucheli noch nicht genug Parteinahme für Israel. Einfach deswegen, weil es auch Binswanger wagt, nach bedingungsloser Verurteilung der Hamas zu schreiben: «Aber auch die Netanyahu-Regierung hat ihren Anteil an der heutigen Tragödie.»
Daraus schliesst Bucheli: «Also doch, die Israeli sind mitschuldig, eigentlich sind sie selber schuld.» Binswanger schreibt viel Unsinn in seinem Kommentar, aber ihm das zu unterschieben, ist infam und unredlich. Die Beschreibung von Ursachen mit Schuldzuteilung verwechseln, das unterläuft Bucheli nicht aus Dummheit. Das ist unredliche Absicht.
Aber immerhin, zum Schluss schreibt Bucheli etwas, das er sich selbst hinter die Ohren schreiben sollte: «Es steckt heute viel Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit in der Debatte um Israel.»
Was auch Bucheli, der vielleicht besser Kinderbücher rezensieren sollte, völlig auslässt: was wäre denn ein möglicher Lösungsvorschlag? Wie könnte man das Problem der Geiseln lösen? Wäre das nicht eine vornehme Aufgabe eines Intellektuellen, nachdem das Israel-Kritiker-Bashing in der NZZ schon flächendeckend stattfand? Sollte nicht aus der Analyse von Ursachen nach Lösungen gesucht werden? Ist es nicht kindisch, stattdessen wie der artige Streber in der Primarschule den Finger hochzustecken und «ich auch, ich auch» zu rufen?
Versuchen wir zu spiegeln, um den unfruchtbaren Unsinn dieses Gewäffels zu zeigen. Als die USA unter dem erfundenen Vorwand, der irakische Diktator Saddam Hussein stelle Massenvernichtungswaffen her und unterstütze den Terror der Al Qaida (was beides erstunken und erlogen war), in den Irak einmarschierten, gab es deutliche Kritik daran. Wurde der damals eigentlich auch immer vorgeworfen, sie müsse dann aber schon auch die Gräueltaten des Diktators erwähnen, bevor sie die USA kritisieren dürfe? Oder gar, wer die USA kritisiere, rechtfertige die Verbrechen des Diktators? Wolle sie ungeschehen, vergessen machen? Wer darauf hinwies, dass Hussein zuvor unterstützt von den und applaudiert durch die USA einen der wohl grausligsten Eroberungskriege gegen den Iran führte, in dem schätzungsweise 800’000 Menschen starben, wurde der gleich als Saddam-Verharmloser beschimpft?
Solche Versuche gab es, aber damals war noch eine offenere Debatte möglich als heute. Wie idiotisch und unproduktiv ist das denn, eine Kritik an Israel nur dann zulassen zu wollen, wenn ihr genügend Abscheu gegen die Gräueltaten der fundamentalistischen Wahnsinnigen der Hamas voranging? Kann man das nicht umdrehen, dass diese Zensoren à la Bucheli jegliche Kritik an Israel mundtot machen wollen? Oder sich anmassen zu sagen: Du darfst Israel vielleicht schon kritisieren, aber nur, wenn Du meine Bedingungen dafür erfüllst.
Es ist bedauerlich, dass sich auch die NZZ gelegentlich solche Taucher in die Morastgebiete des geistig Unverarbeiteten, Unredlichen, Unproduktiven leistet. Das ist weder erkenntnisfördernd, noch enthält es auch nur den Hauch eines Lösungsvorschlags, einer Analyse, einer intellektuellen Durchdringung. Das könnte sie besser.