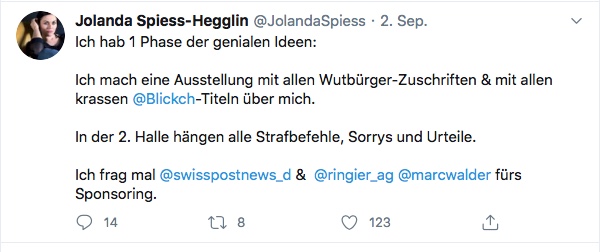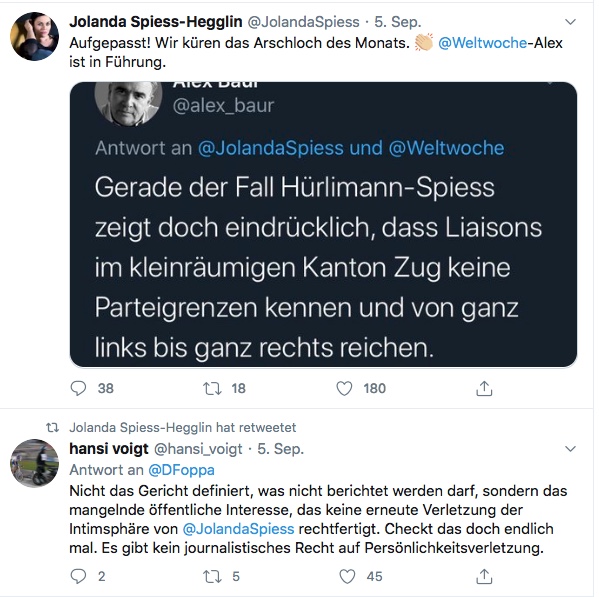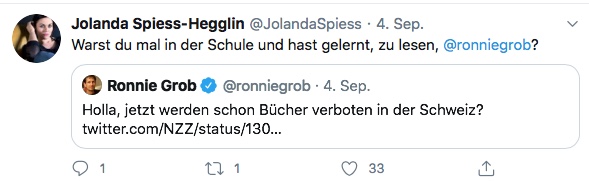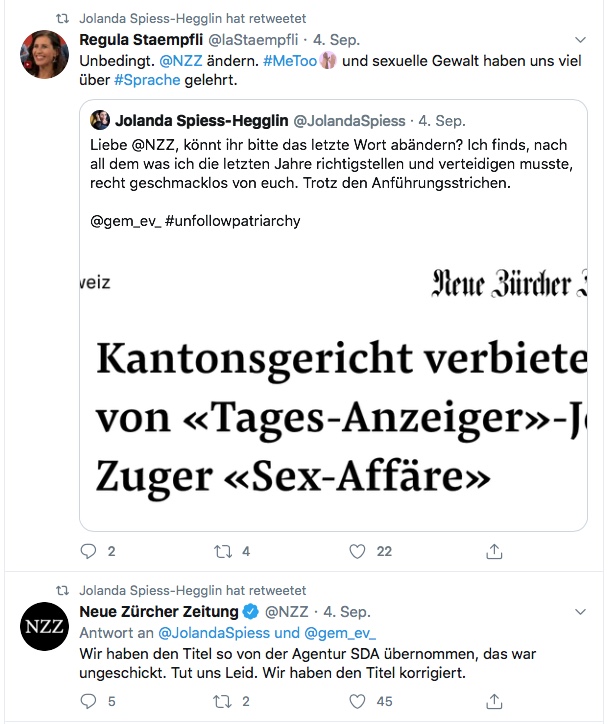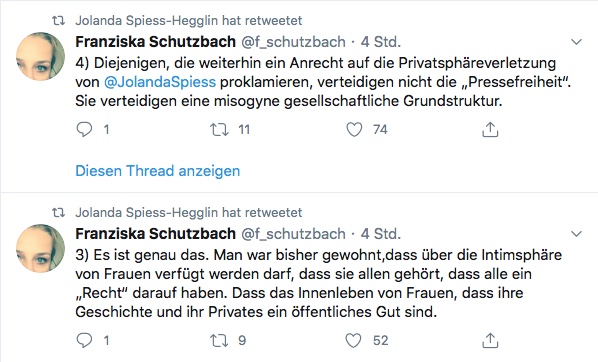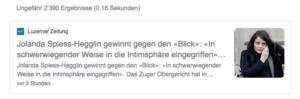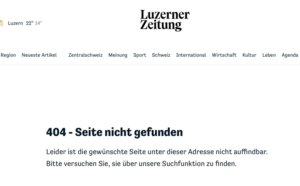Ex-Press VIII
Blasen aus dem Mediensumpf
Früher, als alles noch besser war, gab es – neben der Druckvorstufe – noch drei Berufsgattungen, die heutzutage fast ausgestorben sind. Textchefs, Produzenten und Korrektoren. Deren gemeinsame Aufgabe war, einen Artikel richtig einzuschenken. Also mit einem knackigen Titel zu versehen, einem appetitanregenden Lead und danach ein Lauftext, bei dem sich der Leser nicht in einem Schüttelbecher fühlt.
Natürlich kann man bei den grossen Buchstaben genauso Fehler machen wie bei den kleinen, aber das ist hier schon ein starkes Stück:
«Der Kemel wehrt sich» (Tages-Anzeiger).

Das Kamel wehrt sich? Ein was wehrt sich? Ach so, schliesslich hat Kreml fünf Buchstaben, da kann man doch zwei Fehler machen, und die Mehrheit der Buchstaben ist immer noch richtig.
Auch von Tamedia, auch nicht schlecht: «Der Wunderschuh läutet ein neues Zeitalter ein». Indem er kräftig gegen die Glocke tritt, oder so. Aber immerhin, daran erkennt man, dass es kein bezahlter Text von Nike ist; so einen bescheuerten Titel hätten die sicher nicht gemacht.
«Single, weil die Auswahl scheisse ist», an diesem Titel in «20 Minuten» gibt es nichts zu mäkeln, höchstens, dass so immer mehr Artikel von Tamedia hierhin weitergereicht werden; könnte ja sein, dass ein Leser sie noch nicht kennt.
Nur um Nuancen liegen hier «20 Minuten» und der «Blick» auseinander, abgesehen von der Buchstabengrösse natürlich: «Werde ich sterben?», soll Donald Trump gefragt haben» versus «Donald Trump soll gefragt haben: «Werde ich sterben?» Sollen wir uns das im Rahmen der Feldereinteilung in der Syntaxtheorie mal genauer anschauen? Dachte ich mir doch; was Syntax ist, erklären wir dann im Kurs für Fortgeschrittene.
Auf der völlig sicheren Seite ist für ein Mal sowohl der «Blick» wie auch ein Wetterfrosch:
«Meteorologe warnt: «Es wird noch viel mehr Regen fallen.»
Nun kommen wir schon zum kleinen Intelligenztest; woher stammt dieser Titel: «37 herrliche verrückte Dinge aus Japan»? Gut, eine zweite Chance gebe ich noch: «7 romantische Komödien, die nicht völliger Quatsch sind». Nun hat wohl der Letzte gemerkt, dass es natürlich die Weltzentrale der Listicles ist: «watson». Darauf sollte sich das Online-Organ auch konzentrieren, denn wenn es schwieriger wird, kommt nur noch Blödsinn:
«Die Blockade bei den Bilateralen ist wie ein Smartphone ohne Update».
Geht noch einer drüber? Aber sicher, wozu hat CH Media auch die Brachial-Kolumnistin, die Fettnäpfchen-Fee, die Gähn-Kalauer-Queen Simone Meier: «Er war da: Vieles, was wir über Johnny Depp geschrieben haben, war wahrscheinlich deppert». Fast richtig; nicht vieles, sondern alles. Und nicht nur über Johnny Depp.
Nun ein Aufschwung in die höheren Gefilde des Journalismus; in das Blatt, das sich seit diesem Wochenende auf das Wesentliche konzentriert: «Trump geht es schlechter als von seinem Leibarzt behauptet», weiss Dr. NZZ es besser als die anderen.
Etwas ungenau hingegen das St. Galler Tagblatt: «Velofahrer im Kanton St. Gallen tot aufgefunden». Dafür aber stellt Pascal Hollenstein mal wieder die grossen Zusammenhänge her und gleichzeitig die Schweiz in den Senkel:
«Deutsche Einheit: Die Schweiz im Schmollwinkel der Geschichte».
Wer noch nicht wusste, dass es den gibt und die Schweiz dort stand: macht nix, ist sowieso nur Unsinn.
CH Media, dessen Vorläufer doch enthüllte, dass ein Badener Stapi Fotos seines unverhüllten Gemächts aus seinen Amtsräumen seinem Schnuckiputzi schickte, ist inzwischen natürlich geläutert und gereinigt:
«Irritierend, wie die Chefetage mit den Mobbing- und Sexismusvorwürfen umgeht», verwundert sich CH Media.
Zur Erklärung: Das ewig in Geldnot steckende Organ «Republik» hat mal wieder einen Artikel eingekauft und versucht, ihn zum Skandal aufzupumpen. Was aber wie meist bei der «Republik» schwierig ist, weil es als «Beweis» für schreckliche Zustände bei der Schweizerischen Nationalbank nur eine Handvoll nicht sehr aussagekräfige Fälle gibt. Und zudem die Chefetage sicherlich bezüglich Frauenquote noch etwas Luft nach oben hat. Aber die Verwaltung von bald einmal einer Billion – das sind 1000 Milliarden – Franken, ist ausserhalb von streng feministischen Kreisen vielleicht ein Mü wichtiger.
Uns wird gelegentlich vorgeworfen, wir seien immer so negativ, was wir gar nicht sind. Aber wie auch immer, dieser Titel aus der NZZ am Sonntag ist schlicht und einfach ganz grosses Kino, sollte applaudiert und bewundert werden:
«Krieg in Karabach: Wo man Kalaschnikows auf Wickeltischen ölt»
Viel besser wird’s nicht in Sachen Titel.