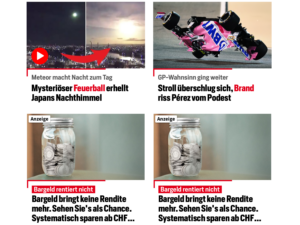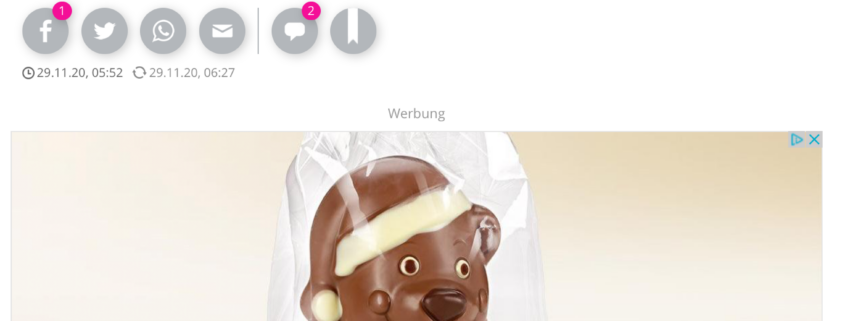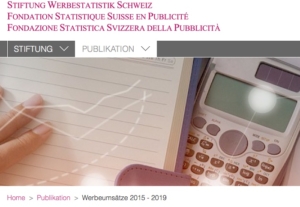Der Schweizer Staat will den notleidenden Medien helfen.
Womit? Mit Geld natürlich. In Form von Subventionen von diesem und jenem. Die Verleger, zerstritten wie sie sind, können sich nicht einmal untereinander einigen, wohin die Giesskanne genau gerichtet werden soll und welche Pflänzchen begossen werden und welche nicht.
Überraschenderweise haben unsere Parlamentarier immerhin zur Kenntnis genommen, dass es seit 30 Jahren ein sogenanntes Internet gibt und darin auch News distribuiert werden.
Dass bislang nur solche Plattformen mit Batzeli bedacht werden sollen, die von ihren Kunden Geld sehen wollen, gehört wieder in den Bereich von Kannitverstan. Eine «Republik» bekäme dann über eine Million aus der Staatskasse, Gratis-Angebote wie «watson», «20 Minuten online», «Inside Paradeplatz», «Die Ostschweiz» oder auch ZACKBUM.ch keinen Rappen.
Den Verlagen ist nicht zu helfen
Aber das ist natürlich nur ein Nebenwiderspruch, wie Marxisten-Leninisten sagen würden. Denn der Hauptwiderspruch ist, dass den Verlagen so gar nicht zu helfen ist. Darin ist für einmal nicht der Staat schuld, sondern die Verlags-Chefetage.
Denn wer bislang meinte, Schweizer Banker in führenden Positionen seien an Inkompetenz nicht zu übertreffen, muss sich eines Besseren belehren lassen. Auch in der Chefetage von Verlagen wird unablässig versucht, das Wort Dummheit zu steigern.
Das äussert sich in einem offensichtlichen Problem, das dicker als ein Elefant mitten im Raum steht, aber von allen Beteiligten konsequent übersehen wird, nach der Devise: Elefant? Was für ein Elefant, wir sehen keinen Elefanten. Wer einen sieht, muss wohl irgendwas nicht Legales geraucht haben.
Der Elefant hört sogar auf verschiedene Namen
Nein, muss man nicht. Der Elefant ist da, ist dick und feiss und hört sogar auf Namen. Er wackelt mit den Ohren, wenn man Google sagt. Er schüttelt den Rüssel, wenn man Facebook sagt. Und wenn man Suchmaschinen und soziale Plattformen sagt, dann nickt der Elefant zustimmend.
Und dann saugt er weiter völlig ungestört fast 90 Prozent aller Einnahmen aus dem Online-Werbemarkt. Wie bescheuert das ist, sei an einem kleinen Vergleich erklärt.
In den guten alten Zeiten, als es noch kein Internet gab, begab sich eine Werbewilliger auf die Inserateannahme einer Zeitung. Dort lieferte er sein Inserat ab und bezahlte je nach Grösse oder Schikanen wie mit Bild, farbig, bestimmte Platzierung, einen hübschen Batzen Geld.
Wieso tat er das? Weil er wusste, dass das Trägermedium seines Inserats durch dessen Eigenleistung, nämlich dem Herstellen von News, genügend Aufmerksamkeit erzielt, die dann auch seiner Werbung zu Gute kommt. Streuverlust, Wahrnehmung, Zielpublikum, all das waren Dinge, über die Werbeagenturen stundenlang quatschen konnten, aber die nicht wirklich messbar waren.
Die Trägerplattform kassiert die Werbefranken?
Natürlich kassierte das Organ, in dem das Inserat erschien, das Geld. Minus Aufwand von Entgegennahme bis Druck und Distribution, ein hübscher Reingewinn. Dann wurde es den Zeitungen zu blöd, den ganzen Aufwand selber zu betreiben, sie beanspruchten die Dienstleistungen von darauf spezialisierten Firmen, die sich dafür natürlich ein Stückchen vom Kuchen abschnitten, so zwischen 5 bis 10 Prozent des Werbeaufwands.
Halt die typische Position des Middle Man, des Vermittlers, des Scharniers zwischen Kunde und Dienstleister. In der Chefetage der Verlage hätte man sich schlapp gelacht, wenn der Mittelsmann verlangt hätte, dass er 90 Prozent der Einnahmen kassiert. Nach dem Gelächter wären Worte gefallen wie unverschämt, unglaublich, was meint der denn, niemals.
Es wäre vor allem erklärt worden: Wir, die Verlage, stellen doch die Plattformen zur Verfügung, auf denen Werbung Wirkung entfaltet, und dafür geben wir auch eine hübsche Stange Geld aus. Also steht uns auch der Löwenanteil der Werbeeinnahmen zu. Ist doch logisch.
Die Butter vom Brot und auch das Brot
Wäre logisch, ist es aber nicht. Die Verlage lassen sich von Google, Facebook & Co. nicht nur die Butter vom Brot nehmen, sondern geben sich mit ein paar Brosamen zufrieden. Während die grossen Gewinner einen kleinen Teil ihres Profits darauf verwenden, ihre Algorithmen immer besser zu machen, damit sie den Inserenten immer besser garantieren können, dass deren Werbung zielgenau abgeschossen wird.
Alter, Geschlecht, Kaufkraft, Konsumverhalten, Vorlieben, Bewegungsprofile, das Datenmeer, das aus dem Unwissen der meisten Benutzer des Internets gewonnen wird, wird gesiebt, geordnet, analysiert. Während die breite Masse bis heute meint, Google & Co. seien gratis, dabei aber mit der neuen Weltwährung bezahlt: mit Daten.
Einfach zuschauen bringt nicht viel
Das ist deren Problem. Das Problem der Verlage ist aber, dass sie diesem Treiben von Google & Co. einfach zuschauen. Und zwar nicht erst seit gestern. Sondern seitdem es Google & Co. gibt. Und auf die Frage, wie es denn sein kann, dass der Mittelmann sich 90 Prozent abgreift, während der grossartige Content Provider, der mit einigem Aufwand die Distributionsplattformen betreibt, sich mit Brosamen begnügt, zucken diese hochbezahlten Manager nur hilflos mit den Schultern.
Da könne man halt nix machen, das sei natürlich unschön, aber ein weltweites Problem, besser Brosamen als gar nichts. Dabei tun sie so, als wäre es sozusagen ein neues Naturgesetz, dass der Mittelsmann sich dumm und dämlich verdient. Da wollen wir aber ein wohlgehütetes Geheimnis verraten: Ist es nicht. Muss nicht sein. Geht auch anders. Man muss halt erfinderisch sein.
Ein obsoletes Geschäftsmodell künstlich am Leben erhalten?
Aus diesem Grund ist der Versuch des Schweizer Staats, den notleidenden Medien unter die Arme zu greifen, nicht nur zum Scheitern verurteilt. Sondern er wäre ein weiteres Beispiel dafür, was staatliche Subventionen eben nicht tun sollen: ein obsolet gewordenes Geschäftsmodell künstlich am Leben erhalten. Geld in ein schwarzes Loch zu werfen, während die Verlage munter weiter sparen und Journalisten abbauen.
Statt solchem Gemurkse könnte man sich vielleicht auf die Grundlage der Marktwirtschaft besinnen. Welche? Na, eine, auf die die Verlagsmanager erst mal wieder kommen müssen. Wenn es Nachfrage gibt, gibt es auch Angebot. Wenn es Nachfrage nach Informationen gibt, in jeder Form und in jedem Niveau, dann gibt es auch ein Angebot dafür.
Ein bescheuertes Geschäftsmodell
Ach, und wie der Anbieter dann Geld damit verdienen kann? Nun, indem er von seinem bescheuerten Geschäftsmodell im Internet Abstand nimmt. Denn ein Modell ist einwandfrei bescheuert, bei dem einer mit einigem Aufwand eine Plattform bastelt, die durch sie generierten Werbeeinnahmen aber von einem anderen weggeschnappt werden.
Das ist ungefähr so bescheuert, wie wenn die Migros, könnte auch Coop sein, sagen würde: Lieber Konsument, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du in unseren Laden und kaufst dort den Liter Milch und bezahlst an der Kasse. Oder aber, du bestellst ihn online, dann liefern wir ihn dir gratis nach Hause, umsonst. Ach, und die Werbung, die draufgeklebt ist, den Platz haben wir auch verschenkt.
Wenn das ein Migros-Manager als neues Erfolgsmodell vorschlagen würde, würde man ihn ruhigspritzen und vorsichtig von zwei weissgekleideten Pflegern aus dem Raum führen lassen. In den Chefetagen der Verlage kann man damit Millionengehälter verdienen.