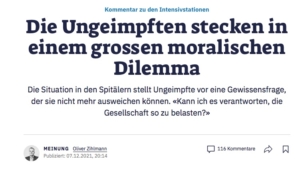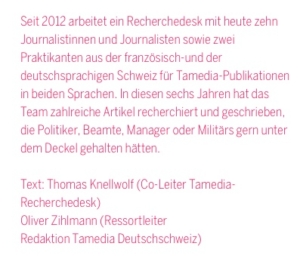Erstaunliche SoZ
Das kann in der Gesinnungsblase Ärger geben.
Diesen Sonntag dürfte so manchem SoZ-Leser das vegane Gipfeli aus der Hand und in den Fair-Trade-Kaffee gefallen sein.
Denn ausgerechnet die SoZ liess erheben, dass bereits 58 Prozent der 0- bis 6-Jährigen Kinder in der Schweiz in einem Haushalt leben, in dem mindestens ein Elternteil im Ausland geboren wurde oder Ausländer ist. Und es wird noch toller: «In der Stadt Zürich haben bereits 70 Prozent aller 15- bis 60-Jährigen Wurzeln im Ausland.»
Erschwerend kommt hinzu, dass die Zahlen für 2019 und 2021 erhoben wurden; seither dürfte sich das Verhältnis noch mehr zu Ungunsten der reinen Eidgenossen verschoben haben. Natürlich wird dann relativiert, umgedeutet und der einzige «Soziologe», der befragt wird, darf sich umfangreich äussern. Sein Name: Ganga Jay Aratnam. Er ist der Soziologe der Wahl, wenn Tamedia (oder auch der «Blick») einen solchen Fachmann brauchen. Offenbar gibt es nur ihn.
Dann lässt die SoZ noch weitere Klischees zerbrechen: «Diese Initiative ist reiner Populismus und hat mit Sozialpolitik nichts zu tun». Wer sagt das über die 13. AHV-Rente? Sicher ein Rechtsausleger. Nun ja, das sagt der ehemalige Zürcher SP-Stapi Elmar Ledergerber. Während auf der gleichen Seite für den SVP-Präsidentschaftskandidaten Marcel Dettling staatliche Kinderbetreuung durchaus in Frage kommt. Das vegane Gipfeli ruht im Fair-Trade-Kaffee und der Gesinnungsblasenleser blättert auf Seite eins zurück, ob er wirklich die SoZ in der Hand hat und nicht etwa die «Schweizerzeit».
Richtig beruhigen tun ihn Artikel über Schneewandern im Bikini oder Müll unter Luxusapartments dann nicht. Ganz sauer wird der Leser dann wieder, wenn sich Rico Bandle die Verwendung von über einer Milliarde Steuerfranken durch den Nationalfonds vornimmt. Ein typischer, rechtspopulistischer und wissenschaftsfeindlicher Ansatz. Denn bitte, Whiteness im Werk Friedrich Dürrenmatts, eine digitale Geografie marginalisierter Sexualitäten in Kirgiesien, Erforschung fellbespannter Streichinstrumente des späten Mittelalters, und als Höhepunkt «Der Klang der Bäume: ökophysiologische Prozesse hörbar machen», das sind doch alles Untersuchungen, die uns nicht reuen sollten, ein paar hunderttausend Steuerfranken darin zu verlochen, Pardon, sinnvoll zu investieren.
Aber es kommt noch schlimmer. Im «Fokus» wird der Gottseibeiuns persönlich interviewt. Der darf doch tatsächlich sagen: «Dieses EU-Mandat ist noch schlimmer als das Rahmenabkommen». Womit er zwar recht hat, aber in der SoZ?
Erst auf Seite 22 erkennt der Leser sein Blatt einigermassen wieder. «Hat ein Schweizer Jetsetter den Fiskus um über 100 Millionen gebracht?» Allerdings ist das ein Bericht des Dreamteams Christian Brönnimann und Oliver Zihlmann über einen skurrilen Erbstreit. Ihre Recherchierleistung bestand darin, sich einfach anfüttern zu lassen. Denn die Witwe des längst verstorbenen Jetsetters, deren Scheidung vor seinem Tod noch nicht durch war, kommt nur an einen grossen Batzen Erbgeld, wenn sie nachweisen kann, dass der Jetsetter in Wirklichkeit seinen Wohnsitz in der Schweiz und nicht im Ausland hatte. Irre Sache, aber wieso damit eine Seite gefüllt werden muss? Um der Witwe die Kosten für ein Inserat zu ersparen?
In der «Wirtschaft» dann immerhin eine nette Enthüllung. Der ehemalige Migros-Manager, der für Benko den Globus-Deal einfädelte, hat eine Gattin. Und die kassierte fett Millionen als Beraterin bei Benno ab.
Brandheiss dann die News bei «Leben & Kultur», dem Abfall-, Pardon, Sammelgefäss für alles, was zwischen Leben und Kultur Platz hat. Zum Beispiel Piero Esteriore. Ja, das ist der, der schon mal seinen Karren in die Eingangstüre des Ringier-Pressehauses an der Dufourstrasse setzte. Aber dann wird wenigstens ein auch etwas in Vergessenheit geratener Star der Gutgesinnung abgefeiert: the one and only Hazel Brugger. Schlagzeile: sie «hätte sich gerne für den «Playboy» ausgezogen». Soll man zu so viel Sauglattismus was sagen? Eben.
Es ist ein Auf und Ab, denn sehr im woken Sinne ist dann wieder ein Biertest. Nein, nicht so einer, ein Test alkoholfreier Biere. Dann noch etwas Beratungskleingeld «Mit diesen Tipps wird aus jedem Badezimmer eine kleine Wohlfühloase». Ach was, wie denn das? Nun, mit einem Tortenständer als Tablettersatz. Plus mildes Licht. Plus eine Wannenbrücke. Und wussten Sie, dass für Badetücher «ihre Saugkraft wichtig» ist? Geben Sie es zu, dass wussten Sie nicht, deshalb baden Sie auch nicht in einer Wohlfühloase.
Gibt es in diesem Brei irgendwo einen absoluten Tiefpunkt? Natürlich, den erkennt man daran, dass auf einer Seite Gülsha Adilji und Markus Somm dilettieren, ergänzt um einen Schnappschuss, diesmal mit – Überraschung – Marco Odermatt. Der hat doch tatsächlich eine Bratwurst gegessen, man hält es kaum für möglich, wenn es nicht fotografisch festgehalten worden wäre.
Aber eine Bratwurst ist meistens schmackhaft- und nahrhaft. Diese SoZ macht es weder ihrem Stammpublikum, noch Zaungästen recht. Sie ist einfach ungeniessbar.