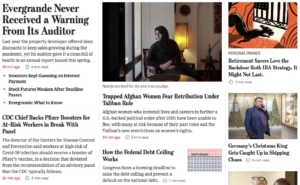«Bild»! Chef! Weg!
Nabelschau aller Orten. Ein Boulevardblatt feuert den Chef. Wahnsinn.
«watson» findet mal wieder die falschen Worte im Titel: «Medien-Tornado in Deutschland». Echt jetzt? Erscheinen die Tageszeitungen wegen Papiermangels nur noch als Faltblatt? Wurde das ß abgeschafft? Hat ein Chefredaktor vergessen, wo er seinen Porsche geparkt hat? Hat Tamedia vergessen, daraus parkiert zu machen?
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Nein, der «Tornado» besteht darin, dass der Chefredaktor der «Bild»-Zeitung gefeuert wurde. Per sofort, denn anders geht das bei einem Chef nicht. Oder um es mit dem «Blick» ganz seriös zu formulieren: «Axel Springer entbindet «Bild»-Chefredaktor Reichelt von seinen Aufgaben». Ist halt schon blöd, wenn man mit Springer als Juniorpartner verbandelt ist.
Eigentlich ist die Story vom Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» schon längst auf den Punkt gebracht worden, wie es ein guter Boulevard-Journalist nicht besser könnte:
«Vögeln, fördern, feuern».
Das scheint eines der Führungsprinzipien von Julian Reichelt gewesen zu sein.
Inzwischen hat der Boulevard-«Spiegel» ganze acht Redaktoren an die Story gesetzt: «Warum Julian Reichelt gehen musste». Die zähe deutsche Regierungsbildung, Corona, Wirtschaft, nichts ist so wichtig wie diese Personalie. Auch in der Schweiz. Das Medienarchiv verzeichnet rund 100 Treffer für Reichelt, alle Schweizer Printmedien haben über den Rausschmiss berichtet.
Eigentlich eine banale Personalie
Dabei ist die Story so banal wie schnell erzählt. Ein erfolgreicher Chefredaktor kann seinen Hosenschlitz bei der Arbeit nicht geschlossen halten, reaktiviert die Casting-Couch und ermöglicht Karrieren per Beischlaf. Eine erste Untersuchung überlebt er noch leicht ramponiert, machte aber offenbar fröhlich weiter.
Bis dem Springer-Boss der Kragen platzt und Mathias Döpfner vornehm zum Zweihänder greift und köpft: «Privates und Berufliches nicht klar getrennt, dem Vorstand die Unwahrheit gesagt, Weg gerne gemeinsam fortgesetzt, das ist nun nicht mehr möglich.»
Um die Absetzung herum entwickelten sich tatsächlich lustige Nebengeräusche. Zunächst ist Reichelt Opfer einer globalisierten Welt. Denn Springer hat sich das Politportal «Politico» in den USA gekrallt. Eigentlich ein kleiner Laden, aber bedeutend als Nahbeobachter der Politik in Washington. Anlass für die NYT, sich den Käufer mal genauer anzuschauen.
So kam Reichelt in die NYT
Auch die grosse «New York Times» kann Boulevard: «At Axel Springer, Politico’s New Owner, Allegations of Sex, Lies and a Secret Payment». Darunter ein Foto von Reichelt, der sich sicherlich nicht gewünscht hätte, einmal so dort aufzutauchen.

Die Recherchen der NYT ergaben offenbar, dass einiges stinkt im Reiche Döpfner, und dass vor allem Reichelt im Zeitalter von «#metoo» schon längst untragbar war. Allerdings durch seinen Erfolg geschützt blieb, denn die «Bild»-Zeitung hat unter seiner Leitung die allgemeine Auflagenerosion zum Stillstand gebracht und durch knalligen Boulevard ihre Rolle als Meinungsbildner aufgefrischt. Denn wie sagte schon Altkanzler Gerhard Schröder so richtig: Man könne in Deutschland nicht gegen die «Bild» regieren.

So geht relevanter Boulevard.
Die Frage bleibt allerdings offen, wieso es genau in Zeiten von «#metoo» genügend willige Weiber gab, die sich tatsächlich den Weg nach oben erschliefen. Aber bald werden wir sicherlich erste Opferschilderungen vernehmen müssen, die wir den Lesern von ZACKBUM aber nach Möglichkeit ersparen.
Eine zweite knackige Nebenstory ergab sich aus der Tatsache, dass parallel zur NYT auch ein Investigativteam der Mediengruppe Ippen dem Unhold Reichelt nachrecherchierte. Aber das Verlagshaus heisst so, weil es dem Senior Dirk Ippen gehört («Frankfurter Rundschau», «Münchner Merkur» und das Boulevardblatt «TZ»).
Der hatte sich gerade, schon wieder Globalisierung, ein Team von der deutschen Ausgabe von BuzzFeed eingekauft. Die wollten als Einstiegskracher ebenfalls die schmutzige Unterwäsche von Reichelt an die Leine hängen. Aber da griff Ippen persönlich ein und stoppte die Publikation zwei Tage vor dem vorgesehenen Zeitpunkt.
Begründung:
«Als Mediengruppe, die im direkten Wettbewerb mit ›Bild‹ steht, müssen wir sehr genau darauf achten, dass nicht der Eindruck entsteht, wir wollten einem Wettbewerber wirtschaftlich schaden.»
Das ist nun putzig und rührend, aber sicherlich nicht die Wahrheit.

Mir san mir und ich bin der Chef: Dirk Ippen.
Wir fassen das laue Lüftchen zusammen, das in den Schweizer Nabelschaumedien Themen wie drohende Energiekrise oder Corona locker wegblies. Ein Boulevardchef knüpft an die schlechten, alten Zeiten an. Sein Verlag stützt ihn als Erfolgsbringer. Der Ankauf eines US-Blogs erregt die Aufmerksamkeit der NYT, was in Deutschland untersagt wurde, wird in den USA publiziert. Weg isser.

Wäre doch eine Knaller-Story hier gewesen …
Sonst noch was? Ach ja, Christian Dorer könnte das garantiert nicht passieren. Ausgeschlossen. Für diesen Schwiegergmuttertraum legen wir die Hand ins Feuer. Vorstellbar wäre ein abruptes Ende höchstens, wenn der Hobbybusfahrer auf dem Fussgängerstreifen einen Rentner mit Rollator totfahren täte.

Under new management, wie der Ami sagt.