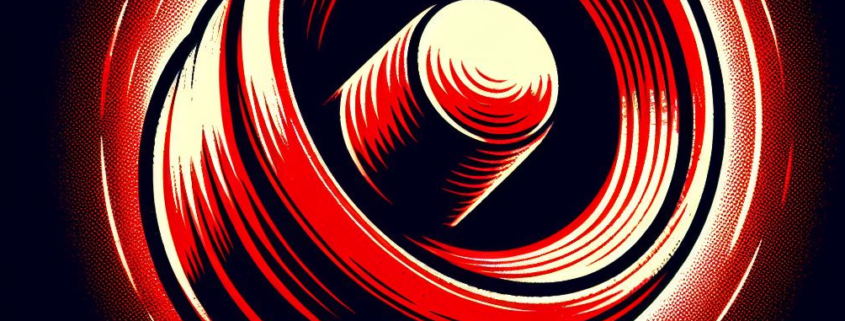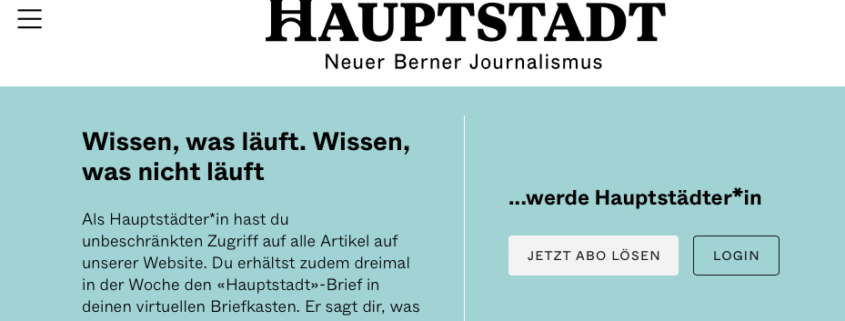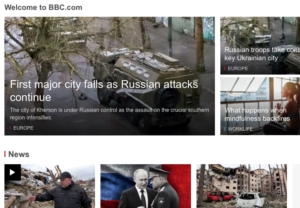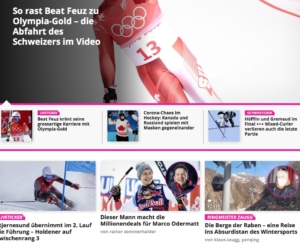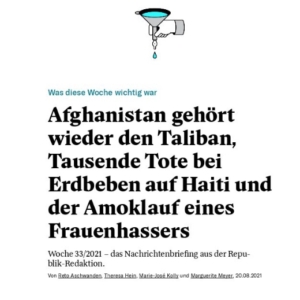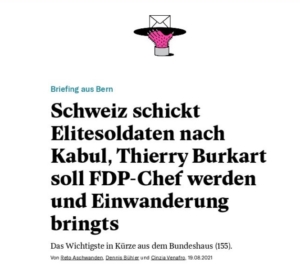Schawi und die Radiozwerge
Wie halten es die Lokalradios mit den Nachrichten?
Radiopionier und Ewig-Pirat Roger Schawinski weiss, wie man «zuerst die gute Nachricht» spielt. Sein «Radio Alpin» hat gerade dem Lebrument-Clan die Konzession für die Süostschweiz weggeschnappt. Nächstes Jahr soll’s losgehen, falls die Einsprache erwartungsgemäss abgeschmettert wird.
Machte Schlagzeilen. Wie immer bei Schawi einiges an Häme, aber auch Lob. Kaum war das verklungen, sozusagen versendet und versandet, neue News aus dem Hause «Radio 1». Ganz erwachsen trennt sich das von seiner Nachrichtencrew, immerhin sechs Nasen.
Ein Teil von Schawinskis Begründung leuchtet ein: Pushmeldungen, unzählige Newsportale im Netz, da hat das klassische Gefäss der Pflichtnachrichten zu jeder Stunde deutlich an Ausstrahlung verloren. Dass Trump auch die zweiten Vorwahlen gewonnen hat, das kann jeder in beliebiger Länge und Geschwindigkeit überall abrufen, da braucht es nicht mehr den Radio-Newssprecher.
Allerdings kann und will «Radio 1» nicht vollständig auf News verzichten. Das hat zum einen mit der Konzession zu tun. Und zum anderen mit doch vorhandenen Hörgewohnheiten. Sonst wäre es ja nur konsequent gewesen, mit der Abschaffung der Redaktion auch die klassischen Newsbulletins abzuschaffen.
Nun mäkeln die wenigen anderen noch unabhängigen Lokalradios daran rum, dass eben die lokale Berichterstattung ein Asset sei, auf das man nicht verzichten könne. Was wiederum eine indirekte Kritik an den beiden Privatradiomonstern CH Media und Energy darstellt. Denn alleine CH Media bedient mit seiner Einheitssauce 12 eigene und 4 Fremdsender. Dagegen haben die x Kopfblätter von Tamedia und CH Media immerhin noch Rumpf-Lokalredaktionen, die den Einheitsbrei aus Aarau und Zürich noch mit Lokalkolorit aufhübschen.
«Radio Top», «Radio Zürisee», «Radio Basilisk», die drei wollen an der eigenen Nachrichtenredaktion festhalten, sich allerdings auf lokale News konzentrieren. Wird spannend zu sehen, wie lange sie noch solche Werbespots senden: «Was in ihrer Region geschieht, erfahren unsere Hörerinnen und Hörer nach wie vor am schnellsten bei Radio Top.»
Denn wie bei den grossen Brüdern und Schwestern im Print gehen natürlich auch an den Privatradios die harten Zeiten mit Werbe- und Hörerschwund nicht spurlos vorbei. Wobei: alle Privaten zusammen erreichen immerhin 2,4 Millionen Hörer, Platzhirsch SRG 2,5 Millionen. Dabei ist die SRG der einzige Sender, der überregional beschallen darf.
«Radio 1» läuft dabei mit weniger als 100’000 Hörern unter Kleingruppenstation; die Platzhirsche «Pilatus» und «Radio 24» («miini Idee xi») haben mehr als doppelt so viele.