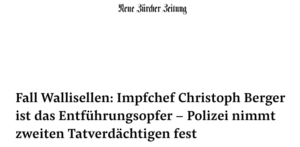«Für den Inhaftierten gilt die Unschuldsvermutung»
Neues aus der Medienkloake.
Natürlich ist ein Verdacht auf sexuelle Handlungen mit Minderjährigen eine schlimme Sache. Sollte er sich bewahrheiten, kann der Verdächtigte nicht nur mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Seine bürgerliche Existenz ist vernichtet, sein Ruf unwiederbringlich beschädigt.
Er verliert Stelle, Ansehen, Karriere, Zukunftsaussichten. Freunde wenden sich von ihm ab, vielleicht auch seine eigene Familie, sein persönliches Umfeld. Er ist stigmatisiert, lebenslänglich. Denn es gibt wohl kaum ein Verbrechen, das in unserer Gesellschaft so Abscheu auslöst wie der sexuelle Missbrauch von Kindern. Nun ja, wenn es katholische Kirchenmänner sind, dann darf die Kirche selber nach dem Rechten schauen. Indem sie so kräftig wie möglich wegschaut Aber das wäre ein anderes Thema.
«Die Oberstaatsanwaltschaft bestätigt am Sonntagabend laut Tele M1, dass gegen X.Y. deswegen ein Strafverfahren läuft.»
Es ist natürlich fast ein Witz, dass hier der Name des Beschuldigten nicht genannt wird. Nicht nur im «Blick» wird weiter kolportiert: «Dem Wirtschaftsinformatiker, der bei der Swisscom arbeitet und rund zwei Jahre für die SVP im Grossen Rat sass, drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis, sollten sich die Tatvorwürfe erhärten.»
Damit sich der Volkszorn auch am richtigen Ort entladen kann, wird nicht nur Name, Foto, Beruf und Parteizugehörigkeit publiziert, sondern auch noch gleich der Wohnort.
In den meisten Berichten, wird noch hinzugefügt. «Für den inhaftierten Politiker, der Mitglied der Justizkommission war, gilt die Unschuldsvermutung.»
Sollte sich die Vermutung zur Gewissheit steigern – er ist unschuldig –, wäre das Resultat für den Betroffenen haargenau das gleiche wie wenn er rechtskräftig verurteilt worden wäre. Er verliert Stelle, Ansehen, Karriere, Zukunftsaussichten. Freunde wenden sich von ihm ab, vielleicht auch seine eigene Familie, sein persönliches Umfeld. Er ist stigmatisiert, lebenslänglich.
Weder die Oberstaatsanwaltschaft, noch die Medien und noch viel weniger die Konsumenten der Medien wissen, ob an der Beschuldigung was dran ist oder nicht. Sicherlich gibt es einen Anfangsverdacht, sonst würden die Strafverfolgungsbehörden nicht Untersuchungshaft verhängen.
Nun ist es aber eigentlich im Zuge einer zunehmenden Zivilisiertheit der Gesellschaft gelungen, sowohl den Schandpfahl wie auch das Gottesurteil oder die Verurteilung durch Volkes Stimme durch ein geordnetes Strafverfahren zu ersetzen.
Eigentlich.
Ein geordnetes Strafverfahren bedeutet, man kann es nicht oft genug wiederholen, dass der Beschuldigte, auch der Angeklagte, selbst der Verurteilte solange als unschuldig zu gelten hat, bis das Gegenteil rechtsgültig festgestellt wurde. Selbst dann, wie man nicht zuletzt aus dem Land der Todesstrafe weiss, gibt es noch die Möglichkeit des Justizirrtums. Also dass ein zum Tode Verurteilter, leider auch posthum, aufgrund neuer Erkenntnisse sich als unschuldig erweist.
Erschwerend kommt hinzu, dass es Delikte und Straftaten verschiedener Verächtlichkeit gibt. Ein Diebstahl ist nicht das gleiche wie ein Raubüberfall. Auch Gewaltverbrechen haben unterschiedliche Eskalationsstufen. Selbst bei Sexualstraftaten gibt es Unterschiede in der gesellschaftlichen Stigmatisierung des Täters. Sexueller Missbrauch von Kindern steht auf der obersten Stufe aller verachtenswerten Straftaten. Überführte Täter haben es auch in Gefängnissen nicht leicht und müssen oftmals einem besonderen Haftregime unterworfen werden, damit sie nicht der Rache anderer Insassen zum Opfer fallen.
Vermutungen wie «da wird doch sicher etwas dran sein», Volkes Wut («Sauhund, kurzen Prozess machen»), die Chance, dass die Unschuldsvermutung mehr als eine hohle Phrase ist, liegt bei null.
«watson», nau.ch, CH Media, Tamedia, «Blick», «20 Minuten», mit der Ausnahme der NZZ haben alle grossen Medienhäuser mit Namensnennung und auch mit Foto über den Fall berichtet.
Es ist möglich, dass der Beschuldigte die ihm zur Last gelegten Straftaten begangen hat. Nur: zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir das nicht. Nur: die Unschuldsvermutung, die schon in so vielen Fällen des Vorwurfs von sexuellem Missbrauch nicht mehr existierte, ist hiermit und endgültig zur hohlen Phrase geworden, zur bitteren Lachnummer. Zur Blase auf dem Mediensumpf, der immer mehr zur Kloake wird.