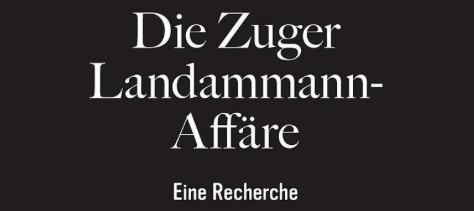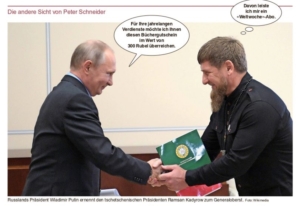War es ein taumelnder Moment der Hemmungslosigkeit?
Wie fremdknutschen zum Geschäftsmodell umfunktioniert wurde. Und eine hasserfüllte Kämpferin gegen Hass zum Opfer ihrer selbst.
Lang ist’s her, seit der Zuger Landammann-Feier im Jahre 2014. Dort begegneten sich zwei Politiker, kamen sich näher, becherten, knutschten öffentlich, wurden zum Thema des Abends – und verschwanden für ein Weilchen in einen Nebenraum. Am Abend wurden sie fotografiert. Beschwingt, nah, sie schmachtet ihn an, mit einem Weinglas in der Hand.
Was verborgen in der «Captain’s Lounge» geschah – oder nicht – ist die Keimzelle einer Affäre, die bis heute nicht aufgearbeitet oder beerdigt ist. Für beide Beteiligten hatte sie dramatische Folgen. Der eine sah sich zu Unrecht der Schändung beschuldigt und stand unter dem Verdacht, seine Abendbegleitung mit k.o.-Tropfen gefügig gemacht zu haben.
Damit war seine politische Karriere erledigt, der mediale Sturm liess ihn beschädigt zurück; er versuchte vergeblich, aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. Wie viele Laien reagierte er aufrecht, aber ungeschickt. Der üble Verdacht, Täter zu sein, blieb trotz eindeutiger Unschuld an ihm kleben; dass er das Opfer der Affäre ist, hat sich nicht als Erkenntnis durchgesetzt.
Die andere Beteiligte hingegen machte aus dem Vorfall ein Geschäftsmodell. Sie brachte es fertig, sich als Opfer zu inszenieren – obwohl es keinen identifizierbaren Täter gibt. Den müsste es aber geben, sollte sie tatsächlich geschändet oder gar vergewaltigt worden sein, wie sie immer wieder insinuiert.
Damit ein intimes Geschehen zwischen zwei Erwachsenen zur Affäre, gar zum Skandal wird, braucht es einige Ingredienzien. Zwei unterschiedliche Auffassungen darüber, was sich abgespielt habe. Massenmedien, die davon Wind bekommen. Und ein Publikum, das voyeuristisch Anteil nimmt, Partei ergreift, jedes noch so unappetitliche Detail begierig aufsaugt – und gleichzeitig seinen Abscheu darüber bekundet.
Ein Mann wurde zu Unrecht beschuldigt
Bei solchen «er sagt – sie sagt»-Storys gibt es immer lebhafte Parteinahme. Der Mann, das Schwein, der Täter. Die Frau, das Opfer, das schuldig gesprochen werden soll. Oder umgekehrt, der Mann, das unschuldige Opfer eines Rufmords. Die Frau, die bösartig einen angetüterten Seitensprung weglügen will.
Dieses Thema – hat er sie gegen ihren Willen oder war sie willig, bereute aber im Nachhinein – ist (Stichwort #metoo) dermassen aufgeladen mit gesellschaftlichen Konflikten bis hin zum Rollenverständnis von Mann und Frau, dass es kaum möglich ist, den Einzelfall als solchen zu betrachten. Schnell geht es um das grosse Ganze, um Sexismus, Unterdrückung der Frau, Männerherrschaft.
Auch ohne dass einer der Beteiligten aus einer intimen Annäherung ein Geschäftsmodell macht, ist es in der Öffentlichkeit kaum möglich, banale rechtsstaatliche Grundsätze in Erinnerung zu rufen. Die lauten hier: ein Mann wurde zu Unrecht der Schändung beschuldigt, zu Unrecht verdächtigt, er solle dafür k.o.-Tropfen benützt haben. Die Strafuntersuchung gegen den Mann wurde nach umfangreichen Ermittlungen, inkl. einer Nacht in U-Haft, eingestellt. Aber das ist blosse Theorie, schon während der medialen Aufarbeitung der Affäre war «es gilt die Unschuldsvermutung» nur eine leere Floskel.
Ein weiteres rechtsstaatliches Prinzip ist die Verwendung und Bewertung von Indizien, von Zeugenaussagen, von Umständen. Beide Beteiligten sagen bis heute, dass sie ab einem gewissen Zeitpunkt des Abends einen Filmriss gehabt hätten, sich an nichts mehr erinnern könnten, bis sie dann in ihrem jeweiligen Daheim aufgewacht seien.
Die Heisenbergsche Unschärferelation
Abgesehen von der Zeit, die die beiden unbeobachtet zusammen verbrachten und wo es zweifellos zu sexuellen Kontakten kam, gibt es aber genügend Zeugenaussagen über ihr Verhalten. Übereinstimmend wird von zunehmender Nähe berichtet, davon, dass die beiden sogar zur Ordnung gerufen wurden, weil sie ungeniert geknutscht hätten und man das im konservativen Zug zwischen zwei anderweitig verheirateten Menschen nicht gerne sah.
Die Beteiligte soll sogar kurz geflüchtet sein und gesagt haben, dass sie beide es nun verbockt hätten, alle hätten es gesehen und wüssten es nun. Es gibt ebenfalls Zeugenaussagen, dass die beiden gegen ein Uhr nachts gemeinsam ein Taxi bestiegen hätten, wobei keiner einen angeschlagenen, unkontrollierten oder betäubten Eindruck gemacht hätte.
Es ist völlig ungeklärt, was in den zwei Stunden zwischen der Abfahrt vom Fest und der vom Ehemann bezeugten Ankunft der Beteiligten geschehen ist. Normalweise dauert eine solche Taxifahrt nicht mehr als zehn, höchstens zwanzig Minuten.
Das ist bekannt, damit hätte es auch sein Bewenden haben können. Aber die Beteiligte – was ihr gutes Recht ist – setzte sich gegen die Berichterstattung zur Wehr und propagierte offensiv und aus eigenem Antrieb ihre Version des Ablaufs, bis hin zur Beschreibung intimster Details ihres Geschlechtslebens.
Durch das Granulieren des Ereignisses, durch unendliche Verästelungen in alles hinein, den Nachweis von Drogen, Alkohol, Geschlechtsverkehr, willig oder wehrlos, durch das unermüdliche Mahlen des Realitätssubstrats entstand das gleiche Phänomen wie in ähnlich gelagerten Fällen. Erinnert sei an die Affäre Kachelmann, wo sich das, was sich wirklich abgespielt haben mochte, wie in einer Heisenbergschen Unschärferelation verlor und auflöste. Oder der berüchtigte Toast Hawaii, wo das Herumbengeln auf einem einzelnen Glied einer Indizienkette sogar einen Mörder freischrieb.
Auch beim Vorfall während dieser Feier haben sich alle Indizien, Herleitungen, hat sich das Logisch-Plausible aufgelöst. Zwei Erwachsene kommen sich – wie genügend Zeugen bestätigen – an einem feuchtfröhlichen Fest näher, können nicht voneinander lassen. Knutschen ungeniert, ziehen sich zurück, tauchen wieder auf, wirken in keinem Moment derangiert, ausser Kontrolle, verhalten sich nicht wie ein Täter und sein Opfer, fahren gemeinsam im Taxi weg, verbringen nochmals Zeit miteinander. War der unbestreitbar stattgefundene sexuelle Kontakt einvernehmlich oder eine Schändung, eine Vergewaltigung gar? Kann es eine Tat ohne Täter geben? Gesunder Menschenverstand und Logik sagen das eine, die Beteiligte sagt das andere.
Mehr als das, sie gründete eine Organisation, die sich für Opfer von Belästigungen im Internet einsetzen will. Sie scharte einen Kreis von Fans und Anhängern um sich, die – oftmals aufgepeitscht von ihr – alle Kritiker ihrer Version des Geschehens wie ein hasserfüllter Mob verfolgten und beschimpften. Es entstand schnell einmal der typische Sektengroove: wer nicht für uns ist und unsere Heldin bewundert, ist gegen uns und böse.
Buchpublikation ausdauernd behindert
Die Tamedia-Journalistin Michèle Binswanger wurde zum Lieblingshassobjekt, seit sie angekündigt hatte, die damaligen Ereignisse mit einem Buch aufzuarbeiten und darin insbesondere dem männlichen Opfer der Affäre Gelegenheit zur Erklärung zu geben.
Die Beteiligte setzte alle möglichen Hebel in Bewegung, um die Veröffentlichung dieses Buchs zu verhindern. Dabei geriet sie in die Fänge einer Anwältin, deren Selbstbewusstsein umgekehrt proportional zu ihren Fähigkeiten steht. Deren Honorarnoten exorbitant, ihre Erfolge für ihre Mandantin aber sehr überschaubar sind.
So gelang es ihr zwar, die Publikation des Buchs «Die Zuger Landammann-Affäre. Eine Recherche» um gut zwei Jahre zu verzögern, aber nicht zu verhindern. Auf sehr wackeligen Füssen steht auch ihre Klage nach Gewinnherausgabe gegen den Ringier-Verlag. Hier lehnte die Beteiligte ein Angebot zur Güte – 150’000 Franken Entschädigung, Entschuldigung plus zweiseitiges Interview mitsamt Werbung für ihre Organisation – ab. Schlecht beraten von einem Irrwisch, der behauptet, der Verlag habe mit seinen Artikeln über die Affäre einen Gewinn von rund einer Million Franken gemacht. Oder einen Umsatz, was für den Finanzlaien das Gleiche ist.
Zurechnungsfähige Berechnungen gehen von vielleicht 10’000 Franken aus. An diesem Beispiel zeigt sich, wie die Beteiligte immer mehr in einen von ihr nicht mehr kontrollierbaren Strudel von Folgewirkungen geraten ist. Der Verein und ihre rechtlichen Auseinandersetzungen brauchen Geld, dafür wurden immer wieder Spendenaktionen losgetreten. Die Buchhaltung des Vereins und das erratische und herrschsüchtige Verhalten der Beteiligten führte zum sofortigen Rücktritt zweier Vereinspräsidentinnen – und ihrer Nachfolgerin.
Inzwischen ist die Recherche von Binswanger erschienen, so mehr oder weniger. Es ist eine faktengetreue Darstellung all dessen geworden, was über die Affäre bekannt ist oder recherchiert werden kann. Das Buch wertet nicht, aber sein Inhalt macht sehr verständlich, dass die Beteiligte alle Hebel in Bewegung setzen will, seine Publikation zu verhindern. Laut der Autorin wird inzwischen auch ihr deutscher Verlag vom berüchtigten Medienanwalt Ralf Höcker bedroht. Da der genau wie die Schweizer Anwältin der Beteiligten für seine barocken Honorarnoten bekannt ist, erhebt sich wieder einmal die Frage, woher sie eigentlich all das Geld für diese Interventionen und Prozesse hat.
Hasserfüllte Kämpferin gegen Hass
Denn durch ihre Unbeherrschtheit und eigene Unfähigkeit verspielte sie sich sogar staatliche Subventionen, was angesichts der Sympathie amtlicher Stellen für ihre Anliegen erstaunlich ist. Kritiker daran, darunter sogar eine Ex-Präsidentin, wurden öffentlich diskreditiert und aus dem Verein ausgeschlossen – ein bei sektenähnlichen Gebilden typisches Vorgehen. Abgesehen von der Anerkennung einer Persönlichkeitsverletzung haben die Beteiligte und ihre Anwältin bislang alle Prozesse krachend verloren.
Um die Publikation dieses Buchs zu verbieten, rekurrierte die Anwältin sogar gegen eine peinliche Niederlage vor dem Bundesgericht – gegen das Bundesgericht beim Bundesgericht. Um unweigerlich eine weitere Klatsche abzuholen. Hier greift zunehmender Realitätsverlust um sich, ein klares Alarmsignal.
Während das männliche Opfer weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden ist und wohl auch durch diese Publikation nicht nochmal in den Fokus gerät, hält die Beteiligte mit der Behauptung, sie wolle eigentlich nur in Ruhe gelassen werden, mit ihren unermüdlichen Kampagnen auf den sozialen Plattformen und polemischen Stellungnahmen gegen alle ihre Kritiker sich selbst im Gespräch.
Auch wenn in der Öffentlichkeit zunehmend Ermüdungserscheinungen sichtbar werden; das hasserfüllte Verhalten der Kämpferin gegen Hass im Internet, ihre beratungsresistente Selbstgewissheit, die keinerlei Selbstkritik zulässt, stösst zunehmend ab.
Auf der anderen Seite hat sie diese Tätigkeit zu ihrem Lebensinhalt gemacht und ist auch finanziell davon abhängig. Also kann sie gar nicht aufhören, ist geradezu süchtig nach medialer Aufmerksamkeit.
Es bleiben nur Opfer zurück
Was auch immer in dieser Nacht in Zug geschah: es blieben zwei Opfer zurück. Eines wurde zuerst als Täter verdächtigt, dann von jedem Verdacht entlastet. Blieb zurück als beschädigtes Opfer ohne grosses Selbstverschulden. Die andere bezeichnete sich von Anfang an als Opfer, insinuierte zunächst, dass sie Opfer des namentlich bekannten männlichen Beteiligten sei. Als sich das nicht mehr halten liess, mutierte sie zum Opfer ohne Täter.
Sie glaubt dabei an Karma. In einer ihrer dunkelsten Stunden behauptete die Beteiligte vor laufender Kamera, dass zahlreichen ihrer Gegenspieler Übles widerfahren sei, Karma eben. Ein sie verleumdender Wirt habe einen schweren Unfall erlitten, ein gegnerischer Anwalt, «ein ganz, ganz böser Mensch, der ist sogar erschossen worden».
Sie spielte damit auf den «Weltwoche»-Anwalt an, der vor Gericht gegen sie angetreten war. Der wurde vor den Augen seiner Kinder als alleinerziehender Vater von einem Nachbarn getötet, worauf sich der Schütze das Leben nahm.
Solche Ausrutscher weisen darauf hin, dass sich die Beteiligte weitgehend in einer eigenen Welt verloren hat. Unabhängig davon, ob sie vor inzwischen 8 Jahren zum Opfer wurde oder nicht: seit vielen Jahren ist sie nun Opfer.
Opfer ihrer selbst.