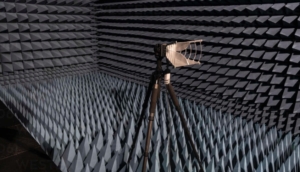Was ist schlimmer? Schwer zu sagen, wenn man Marko Kovic liest.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Kovic ist als soziologische Allzweckwaffe schnell zum Medienstar aufgestiegen. Denn er verbrämt mit pseudo-wissenschaftlichem Gedöns, was der Mainstream gerne hören möchte.
Der hört gerne, dass es ein dunkles Imperium von rechtsradikal-konservativ-populistischen Hetzerplattformen gibt. Dort hat man sich von jedem zweckrationalen Diskurs verabschiedet und dumpft mit den absurdesten Verschwörungstheorien vor sich hin.
Dabei befleissigt sich Kovic der gleichen Methoden, die er diesen Dumpfbacken von Alt-Right vorwirft. So nimmt er sich schon mal das «intellectual dark web» (IDW) vor, das es nicht nur auf Englisch, sondern natürlich auch auf Deutsch gebe.
Dort kenne man «die wahre Wahrheit» und lehne «die wissenschaftliche Sicht» ab, polterte Kovic schon auf der «Medienwoche».
Da haben sich diese Autoren aber schwer geschnitten, denn die einzige Wahrheit kennt natürlich nur Wissenschaftler Kovic. Die üblichen Verdächtigen um Roger Köppel breiten sich so aus:
«Von «alternativen» Kanälen wie YouTube und Podcasts über quasi-journalistische Meinungspublikationen wie die «Weltwoche» oder den «Schweizer Monat» bis hin zur Neuen Zürcher Zeitung.»
Man kann nun über diese Medien einiges sagen, durchaus auch kritisches. Wer aber die NZZ als «quasi-journalistische Meinungspublikation» heruntermacht, hat jeden Anspruch darauf, ernst genommen zu werden, verspielt. Er enttarnt sich als genau gleiche Dumpfbacke in seiner Gesinnungsblase wie die durchaus vorhandenen Spinner auf einschlägigen Plattformen. Als Heuchler, der gegen Hass antreten will, aber selbst Hass versprüht.
Kovic bedient die richtigen Meinungsknöpfchen
Also müsste man Kovic wirklich nicht mehr weiter ernst nehmen, wenn er eben nicht die Narrative seiner Gesinnungsfreunde bedienen würde. Dabei gesteht er sogar eine Wissenslücke ein, die alleine schon ausreichte, um ihn als Gesprächspartner zu disqualifizieren.
Im Interview mit persoenlich.com wird er gefragt, ob ihn das Buch «Hass im Netz» von Ingrid Brodnig inspiriert habe, auch selbst ein Buch darüber zu basteln. Verblüffend offene Antwort: «Mit Schamesröte im Gesicht muss ich gestehen: Frau Brodnigs Buch kenne ich noch gar nicht. Das ist Pflichtlektüre, die ich unbedingt nachholen muss.»
Man kann ja nicht immer auf dem Laufenden bleiben, schliesslich ist das Buch brandaktuell und erst vor Kurzem erschienen. Also genauer gesagt 2016. Aber Selbstvermarktung, das kann Kovic viel besser als wissenschaftliche Methodik. Denn nun schreibt er selber ein Buch über Hass im Internet, und als Vorbereitung zur Publikation bekommt er natürlich eine Plattform auf der «Republik».
Ganz abgesehen davon, dass Kovic eigentlich nur aus Wissenslücken zu bestehen scheint. Welche bescheidene Insight zeigt er, wenn man das mit seriösen Versuchen vergleicht, die Bubble von Corona-Verschwörungstheoretikern aufzuarbeiten. Wobei die Angabe eines solchen Links eigentlich brandgefährlich ist, weil der wohl eine schöne copy/paste-Vorlage für den Wissenschaftler Kovic enthält …

Hochgezwirbelte, animierte Illu (Screenshot «Republik»).
Schon bei seinem damaligen Artikel in der «Medienwoche» schrieb ZACKBUM seherisch über die Qualität des Ergusses von Kovic:
«Sinnlos, zwecklos, hirnlos, intellektuell anspruchslos, aber in «Republik»-Länge. Kovic will diese Stimmen einer Gruppe zuordnen, diese Gruppe in eine gemeinsame Geisteshaltung pressen, die lächerlich machen und denunzieren. In «quasi-journalistischen» Organen äusserten die unwissenschaftlichen Stuss und beschwerten sich öffentlich darüber, dass man sie öffentlich nicht genügend wahrnehme. Ein Trottelhaufen, mit anderen Worten. Lächerlich, aber gefährlich.»
Nun hat sich Kovic – ist auch schon ein Weilchen her – in Todesgefahr begeben und einen Selbstversuch unternommen. Er bewegte sich eine Woche lang auf Plattformen, die Alt-Right zuzuordnen sind. Namentlich Parler, Gab, Bitchute und /pol/.
Nichts Neues von Verschwörungstheoretikern
Das ist nun mässig spannend, und seine Erkenntnisse sind mässig originell oder erhellend. Natürlich die richtigen Voraussetzungen, um fast 22’000 Anschläge mit kaltem Kaffee abzusondern. Inhalt: banale Aufzählungen von Spintisierereien auf diesen Kanälen, flache Selbstdiagnosen, was die Auswirkungen auf den Betrachter betrifft, bis schliesslich den wenigen Lesern, die bis dorthin durchhielten, der letzte Satz wie eine Erlösung vorkam: «Höchste Zeit, das Experiment zu beenden.»

Auch schon ein Weilchen her; wer’s damals überlas …
Erkenntnisgewinn: null. Dass das Internet, insbesondere soziale Plattformen, übervoll von Verpeilten, Verschwörungstheoretikern und Wahnsinnigen ist, kann nun niemanden überraschen.
Dass die sich in unter Luftabschluss verfaulenden Echokammern bewegen, die selbstverstärkend Fehlmeinungen bestätigen, ist auch schon mindestens seit 2016 diagnostiziert. Dass es buchstäblich alles gibt darunter, von links bis rechts, esoterisch, faschistisch, rassistisch, linksradikal, antikapitalistisch, fundamentalistisch: what’s new about that.
Zu lustigem Erkenntnisgewinn führt einzig die Antwort auf die Frage, wieso Kovic denn nun mit solchen Banalitäten eine dermassen hohe Aufmerksamkeit erzielen kann. Genau, weil er in der entsprechenden Meinungsbubble als Echo und Verstärker der eigenen Ansichten hochwillkommen ist.
Richtig witzig wäre es doch mal, sich eine Woche lang auf Plattformen der Linksalternativen zu bewegen. Vom «Megafon» über die «Republik» bis zur WoZ, wenn man so gemein wie Kovic sein will, die WoZ als NZZ-Substitut ebenfalls in diese Dumpfblase einzuordnen. Was sie natürlich auch nicht verdient hat.