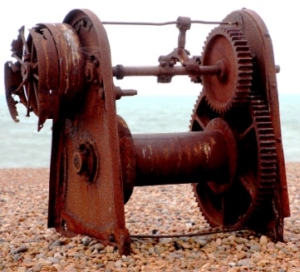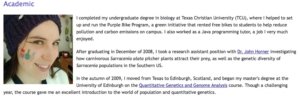Meinungen vom Heiligen Gral
Wer Wirtschaftschef bei der NZZ ist, ordnet die Welt.
Chanchal Biswas kletterte gelenkig und nicht nur für NZZ-Verhältnisse schnell die Karriereleiter hoch. Unterbrochen von kurzen Abstechern in die Privatwirtschaft wurde er 2019 Leiter der Wirtschaftsredaktion der NZZaS, als zusammengelegt wurde, zog der Kapitän des Beiboots am Steuermann des Tankers vorbei.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Seither beschallt er die Wirtschaft mit seinen Kommentaren. Es steht zu vermuten, dass er als Freizeitsport Slalomfahren betreibt. Einen solchen legt er zum Beispiel mit «Die Strafzahlung in Frankreich hat auch etwas Gutes für die UBS-Mitarbeiter» hin.

Dort wurde die Grossbank gerade auch in der zweiten Instanz in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Für die illegale Anwerbung von Kunden und Geldwäsche im Zusammenhang mit Steuerbetrug. Strafrechtlich veruteilt, das nennt man einen neuen Tolgen im Reinheft. Ach, und die Kleinigkeit von 1,8 Milliarden Euro muss die Bank auch noch abdrücken.
Oder in den Worten von Biswas:
«Es scheint, dass die Bank im Berufungsprozess mit ihrer neuen Verteidigungsstrategie gut gefahren ist.»
In erster Instanz war sie noch zur Zahlung von 4,5 Milliarden verknurrt worden. Auch gegen das zweite Urteil kann noch Berufung eingelegt werden.
Weiterentwicklung der Relativitätstheorie
Nun ist bekanntlich alles relativ im Leben. Auch in Relation dazu, dass die Bank vor fünf Jahren gegen eine Zahlung von 1,5 Milliarden ohne Vorstrafe hätte davonkommen können. Aber das schlugen die drei massgeblichen Figuren aus. Ex-CEO Sergio Ermotti kann ein Vermögen von rund 200 Millionen Franken streicheln. Der abgängige Chief Legal Markus Diethelm muss mit insgesamt 100 Millionen auch nicht am Hungertuch nagen. Und Noch-VRP Axel Weber bekommt für sein süsses Nichtstun insgesamt 50 Millionen.

So sähen sich Plisch und Plum gerne.
Sicher, Peanuts, im Vergleich zu rund 2 Milliarden Franken Busse plus Vorstrafe. Aber ist die Bank damit «gut gefahren»? Aber sicher, wenn alles relativ ist: «Gerade im Vergleich mit der angeschlagenen Credit Suisse wird die UBS heute als solides und gut geführtes Finanzinstitut wahrgenommen», nimmt Biswas wahr.
Aber dann geht doch der Slalomfahrer mit ihm durch: «Ein Erfolg also für die Schweizer Bank? Klar. Aber das Steuerverfahren in Frankreich muss den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch eine Mahnung sein. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Bank heute erfolgreich wirtschaftet.»
Selbstverständlich ist das allerdings nie, wie Biswas weise und richtig feststellt. Dann zählt er aus dem umfangreichen Sündenkatalog der Bank ein paar Höhepunkte auf, ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit. Um den Leser schliesslich völlig verwirrt zurückzulassen:
«Dass der Steuerstreit mit dem französischen Staat der UBS erhalten bleibt, ist für die bankinterne Hygiene gar nicht schlecht. Er erinnert an die pannenreiche Vergangenheit – und daran, dass Übermut vor dem Fall kommt.»
Wenn wir die Stimme aus dem heiligen Gral der Wirtschaft richtig verstehen, ist diese Busse also Ausdruck eines Falls nach Über-, eventuell sogar Hochmut. Wobei die UBS allerdings mit ihrem Übermut gut gefahren ist. Oder eine neue Panne an alte erinnert. Aber auf jeden Fall ist die Credit Suisse noch viel schlimmer dran.

So sieht der Aktienkurs einer soliden und gut geführten Bank aus.
Schliesslich nimmt man die vorbestrafte Bank mit langem Sündenregister als «solide und gut geführtes Finanzinstitut» wahr. Echt jetzt? Weil der Aktienkurs der UBS immer noch zweistellig ist, aber um die 16 Franken herumdümpelt, wo er doch mal stolze 75 Franken betrug?
Kurs im Schönschreiben
Relativieren ist schon gut, aber dieser Slalom erinnert doch fatal an Berichte in Staatsorganen des längst verblichenen Sozialismus, wo auch Stillstand, Rückschritt oder krachende Niederlagen schöngeschrieben wurden.

Mann mit Maske: Chief Legal Markus Diethelm in Paris.
Denn eine Riesenbusse, auch wenn sie kleiner geworden ist, plus ein schwarzer Fleck auf der bekleckerten weissen Weste, das ist nichts Gutes für niemanden. Nicht für die UBS-Mitarbeiter, deren Wertschöpfung damit vermindert wird. Nicht für UBS-Kunden, die sich fragen dürfen, ob sie mit einem solchen Geldhaus weiter Geschäfte machen wollen.