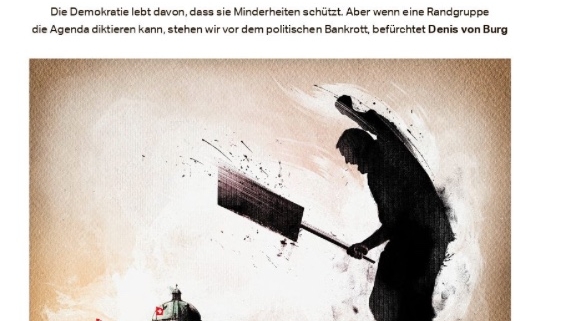Früher war ein «Leitartikel zum 1. August» noch was.
Mario Stäuble ist, viele wissen das nicht, Co-Chefredaktor des «Tages-Anzeiger». Die Zeitung war einmal, viele wissen das nicht mehr, eine ernstzunehmende Stimme in der öffentlichen Auseinandersetzung. Neben viel Eigenrecherche positionierte sich der Tagi mit kantigen Kommentaren und intelligenten, elegant geschriebenen Kolumnen.
Inzwischen werden grosse Teile des Inhalts von der «Süddeutschen» aus München übernommen. Eigenleistungen spielen sich häufig in Themengebieten wie der Genderfrage ab, die 98 Prozent der Konsumenten eher nicht interessieren. Als Grossleistungen sind höchstens noch die Beteiligung an der Ausschlachtung von gestohlenen Geschäftsunterlagen zu erwähnen. Die Hehlerware wird dann von Anklägern, Richtern und Vollstreckern in einer Person dem Publikum als «Papers» oder «Leaks» präsentiert.
Beim letzten Versuch klagte der Tagi selber, dass es sich um einen Skandal handle, der keiner wurde. Oder einfacher ausgedrückt: es war wieder ein Flop.
Im allgemeinen Niedergang bietet die Chefredaktion des Tagi ein besonders jämmerliches Bild. Sie reagierte verschreckt und duckmäuserisch auf ein Protestschreiben erregter Tamedia-Mitarbeiterinnen, die Sexismus, Diskriminierung und unerträgliche Arbeitsbedingungen beklagten. Unterfüttert mit einer Latte von anonymisierten, nicht nachprüfbaren, weder zeitlich noch sonst verorteten Beispielen von angeblichen Übergriffen.
Anlass zu Fremdschämen und peinlicher Berührtheit beim Lesen gibt regelmässig Mario Stäuble. Zuletzt wurde er verhaltensauffällig mit einer oberhochnotpeinlichen und gewundenen Erklärung, wieso der Tagi den Namen eines Entführungsopfers zuerst nannte, dann nicht mehr nennen durfte. Die einfache Begründung wäre gewesen: der Tagi, in erster Linie seine Chefredaktion, haben’s versemmelt.
Vergessen wir die Vergangenheit. Leiden wir unter der Gegenwart
Schlamm drüber. Nun vergreift sich Stäuble aber am 1. August. Was immer man von diesem Datum halten mag, ob es Anlass zur Besinnung, zur Feier, zur Freude, zum Schämen oder was auch immer ist: man sollte zumindest in Würde und auf einem minimalen intellektuellen Niveau darüber nachdenken oder schreiben.
Zwei Gebiete, die nicht zu den Kernkompetenzen von Stäuble gehören. Keiner zu klein, grossmäulig zu sein:
«Die Idee der Schweiz als isolierte Insel ist überholt. Das Land braucht ein neues Selbstverständnis.»
Das ist ja mal eine Ansage. Sie krankt schon daran, dass es in der Schweiz wohl keinen Robinson Crusoe gibt, der sie als isolierte Insel anschaut. Und was für ein neues Selbstverständnis soll gebraucht werden, welches alte ist überholt?
Stäuble holt tief Luft und zitiert aus einer Rede des ersten Schweizer Literaturnobelpreisträgers Carl Spitteler, in der er sich darüber freute, dass eine «Ausnahmegunst» der Schweiz erlaubt habe, während des Ersten Weltkriegs «im Zuschauerraum zu sitzen».
Wie jeder Halbgebildete greift sich Stäuble aus einer längeren Entwicklung von Gedanken einen Satz heraus, der ihm in den Kram passt. Es lohnt sich aber tatsächlich, diese Rede nachzulesen, gehalten am 14. Dezember 1914.
Wer das tut, erfährt, dass sich Spitteler nicht über eine Sonderrolle der Schweiz ausliess, sondern in erster Linie seiner Besorgnis Ausdruck gab, ob sich angesichts des europäischen Schlachtfelds der französische und der deutsche Teil der Schweiz nicht näher zu den jeweiligen grossen Nachbarländern als zur gemeinsamen Sache der Schweiz fühlen könnten.
Stäuble galoppiert durch Niemandsland der Gedankenfreiheit
Die Rolle von Grossmächten brachte Spitteler übrigens schneidend scharf und gut auf den Punkt:
«Nicht umsonst führen die Staaten mit Vorliebe ein Raubtier im Wappen. In der Tat lässt sich die ganze Weisheit der Weltgeschichte in einen einzigen Satz zusammenfassen: Jeder Staat raubt, soviel er kann. Punktum. Mit Verdauungspausen und Ohnmachtanfällen, welche man „Frieden“ nennt.»
Genauso klar äussert er sich auch zur Position der Schweiz in Kriegszeiten zwischen sie umgebenden Grossmächten: «Der Tag, an dem wir ein Bündnis abschlössen oder sonstwie mit dem Auslande Heimlichkeiten mächelten, wäre der Anfang vom Ende der Schweiz.»
Was Spitteler für den «richtigen, den neutralen, den Schweizer Standpunkt» hält, das lohnt sich wahrhaftig nachzulesen. Das hat mit dem herausgerissenen Zitat von Schäuble null und nichts zu tun. Der Co-Chefredaktor startet also mit einer Bauchlandung. Und von da an geht’s weiter nach unten.
Denn nun versucht er es mit falschem Pathos: «Ein Krieg ist ausgebrochen, und 27 Energieminister kommen zusammen, um einen Kontinent zu einen. Russland hat die Ukraine überfallen und setzt seine Erdgasvorkommen als Waffe gegen Europa ein. Die EU-Minister beschliessen, jedes Land werde seinen Gasverbrauch um 15 Prozent senken, um sich aus Putins Würgegriff zu befreien. Das ist historisch – auch wenn der Plan jede Menge Ausnahmen enthält.»
Es ist ein löchriger, nicht funktionierender Plan von 27 EU-Ministern. Obwohl die Schweiz bekanntlich nicht Mitglied in diesem Verein ist, fragt Stäuble inquisitorisch: «Was ist eigentlich mit der Schweiz? Ist man Teil dieses Plans?»
Gegenfrage: wieso genau sollte die Schweiz Teil eines unrealistischen EU-Plans sein? Dem viele Minister im festen Wissen zustimmten, dass er sowieso nicht funktionieren wird?
Schrecklicher Sonderfall Schweiz
Der Bundesrat setze da weiterhin auf den «Sonderfall Schweiz», schreibt Stäuble anklägerisch. Schlimmer noch: «Es ist nicht das erste Mal, dass dies seit Kriegsausbruch passiert. Die verspäteten Sanktionen gegen Russland sind ein Beispiel, das Nein zur Aufnahme von Verletzten aus der Ukraine ebenfalls.»
Verspätete Sanktionen? Die erstmalige Übernahme von Sanktionen, die nicht vom UN-Sicherheitsrat, sondern von der EU beschlossen wurden? Und was für ein «Nein» meint Stäuble hier? Hat er auch das nicht verstanden?
Nun, falsch zitiert, anderes auch nicht kapiert, worin sollte denn nun das «neue Selbstverständnis» bestehen? «Zur Neupositionierung der Schweiz gehört, dass sie ihr Verhältnis zur EU entkrampft.» Ach was, und was würde eine Entkrampfung der Schweiz bringen?
«Nur so wird es gelingen, dass man etwa Entwürfe von Sanktionen gegen Russland im Vertrauen vorab zu sehen bekommt, statt die Informationen nachträglich im Internet suchen zu müssen.» Das ist nun so jämmerlich und lächerlich, dass man beim Lesen nicht weiss, ob man weinen, lachen oder mitleidig den Kopf schütteln soll.
Aber wir sind tapfer und zitieren noch die Schlusspointe: «Zwischen Bern und Brüssel braucht es Nähe und Vertrauen. Nur schon, um für den Tag gewappnet zu sein, an dem Carl Spittelers «Ausnahmegunst des Schicksals» plötzlich ausläuft.»
Ein Leitartikel als Leidartikel
Nähe und Vertrauen? Mit dem dysfunktionalen, undemokratischen, «sanften Monster Brüssel», wie das Hans Magnus Enzensberger nannte. Untertitel seines genialen Essays: «Oder die Entmündigung Europas». Und das schrieb er noch lange bevor sich die EU entschloss, militärisch einem Nicht-NATO-Mitglied zu helfen.
Denn was Spitteler ironisch «Ausnahmegunst des Schicksals» nannte, ersparte der Schweiz Leid und Zerstörung im Ersten Weltkrieg. Es ersparte der Schweiz Leid und Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Sie hat sich dabei nicht nur mit Ruhm und Ehre bekleckert, sie hat sich auch durchgewurstelt. Na und? Hätte sie sich damals auf eine Seite stellen sollen? Auf die der Faschisten? Oder der Alliierten, zu denen nebenbei auch die ehemalige Sowjetunion gehörte?
Wer das auch im Nachhinein korrekt mit nein beantwortet, soll heute für Schulterschluss, «Nähe und Vertrauen» mit Brüssel sein?
Es ist tragisch. Es ist jämmerlich. Es ist peinlich. Es ist bedauerlich, auf welches Niveau ein Leitartikel zum 1. August im Tagi abgesunken ist. Es ist ein Leidartikel. Es ist ein Schriftstück, das Mitleid auslöst. Man wünschte der schrumpfenden Leserschar des Tagi etwas Besseres für den 1. August. «Betet, freie Schweizer, betet», heisst es in der Nationalhymne. Wir wissen hier, worum gebetet werden sollte: Oh Herr, lass Hirn vom Himmel regnen.