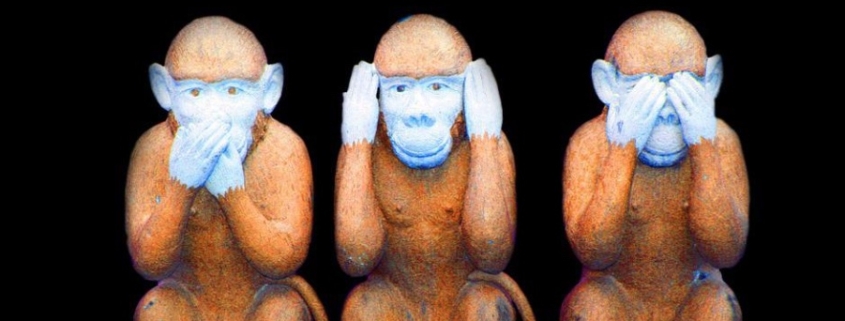Charakterlumpen
Aus rechtlichen Gründen wahren wir die Anonymität. Aber wohl jeder weiss, wer gemeint ist.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Kevin Spacey war einer der besten und vielbeschäftigten Hollywoodstars unserer Zeit, In «House of Cards» hatte er die Rolle seines Lebens gefunden. Bis er Jahre zurückliegender sexueller Belästigungen bezichtigt wurde. Von einem Moment auf den anderen verlor er alles. Ruf, Karriere, Geld.
Der hetzende Mob in den sozialen Medien, begleitet vom hetzenden Mob in den Massenmedien, senkte den Daumen über ihn. Der mediale Volksgerichtshof entschied: schuldig im Sinne der Anschuldigung, Gerichtsverfahren überflüssig, klare Sache. Nachdem Spacey nun von allen Anschuldigungen freigesprochen wurde, hat sich der verbale Lynchmob, wie seine realen Vorgänger in der Geschichte, still und leise verkrümelt. Ohne ein Wort des Bedauerns. Nur einem Mann wie Spacey mit gewissen finanziellen Möglichkeiten war es überhaupt vergönnt, das juristisch durchzustehen.
Finn Canonica hat nicht so viel Geld wie Spacey. Er begann, in Deutschland gegen den «Spiegel» zu prozessieren, der einer rachsüchtigen ehemaligen Mitarbeiterin von ihm, die zudem gefeuert worden war, eine Plattform geboten hatte, um eine Kaskade von erfundenen oder nicht belegbaren Beschuldigungen über ihn auszuschütten. Als ihm das Geld ausging, triumphierte der «Spiegel», er habe gesiegt. Dabei hat die üble Nachrede, die Existenzvernichtung mittels Anschuldigung von Belästigungen gesiegt.
Dieser Fall beinhaltet noch eine Steigerung der Widerwärtigkeit. Dass die üblichen Japser und Hetzer über Canonica herfielen, wie sie das unbelehrbar immer tun, leider normal heute. Aber seine Beschuldigerin fühlte sich so unangreifbar und sicher, dass sie sogar behauptete, bei gewissen Vorfällen sei die Redaktion Zeuge gewesen. Offensichtlich besteht diese Redaktion aber aus Charakterlumpen.
Denn kein Einziger dieser tapferen Verteidiger des Guten, dieser Besserwisser und moralisch Überlegenen, kein Einziger dieser Rechthaber, dieser Kämpfer für Menschenrechte, kein Einziger dieser Heuchler und Feiglinge kam auf die Idee, öffentlich Zeugnis abzulegen. Sei es als Bestätigung der Beschuldigungen, sei es als Dementi.
Leider machen diese Charakterlumpen sogar noch weiter Karriere, so verludert ist der Journalismus inzwischen.
Der zurzeit im Feuer von anonymen Beschuldigungen stehende Journalist wirft mit seinem Fall ein weiteres Schlaglicht auf die verlotternden Sitten und Zustände in angeblich linken, moralisch sauberen Redaktionen. Zum einen ist es keine Art, schon wieder höchstwahrscheinlich längst verjährte Anschuldigungen aus feiger Anonymität heraus zu kolportieren. Sind sie verjährt, dann besteht der einzige Gesetzesverstoss in einer Persönlichkeitsverletzung des Beschuldigten.
Dafür gibt sich sogar das Staatsradio hin, ein Sender, der eigentlich gewissen journalistischen Mindeststandards genügen sollte. Wie eine solche Denunziationsorgie durch alle Kontrollinstanzen rutschte und ausgestrahlt wurde, inklusive einer faktischen Enthüllung des Namens des Angeschuldigten, ungeheuerlich.
Aber das kann man noch steigern. Stimmen die Angaben, dann war das übergriffige und triebhafte Verhalten des Journalisten schon seit vielen Jahren bekannt. Nicht mal ein offenes Geheimnis. Allerdings kam es nie zu einer einzigen Anzeige, nie zu einer einzigen Beschwerde bei den dafür reichlich vorhandenen Institutionen. Aus unerfindlichen Gründen scheinen sechs Frauen beschlossen zu haben, gemeinsam und in feiger Anonymität erst heute über ihn herzufallen. Bislang mit dem üblichen, vernichtenden Erfolg.
Aber: dieses so verdammenswerte Verhalten des Journalisten haben über all die Jahre so sensible Redaktionen wie die vom «Magazin», von der WoZ, von der «Republik» nicht bemerkt? Stimmt es etwa nicht, dass mehr als einmal sein Verhalten recherchiert wurde, entsprechende Artikel aber abgewürgt, nicht publiziert wurden? Stimmt es etwa nicht, dass dieses Verhalten Bestandteil von Redaktionsklatsch war?
Und jetzt wollen all diese Charakterlumpen nichts gewusst haben, nichts gehört haben, nichts mitbekommen haben? Sind alle erschüttert, entrüstet, entsetzt, verurteilen entschieden, finden strenge, strafende Worte? Nachdem sie den Beschuldigten jahrelang als Star abfeierten, seine immer merkwürdiger werdenden Reportagen mit Jubelschreien begrüssten? Meinen sie ernsthaft, dass ihnen das noch jemand abnimmt?
Mit welchem moralischen Recht soll denn das «Magazin», die WoZ, die «Republik» jemals wieder einen Artikel über sexuell übergriffiges Verhalten am Arbeitsplatz schreiben? Traut sich einer dieser Charakterlumpen tatsächlich, einen weiteren Kommentar gegen Männerherrschaft, gegen Diskriminierung, für die Recht der Frau zu schreiben? Ohne dabei rot zu werden?
Das Allerletzte bei dieser ganzen Veranstaltung ist: natürlich werden sie all das tun. Es wird nach der ersten Schrecksekunde ein unerträgliches Gequatsche und Geschwurbel geben, eine Mischung aus ganz leiser Selbstkritik und ganz viel Eigenlob, dass man nun aber alles viel besser aufgestellt habe, das ein Weckruf war, so etwas nie mehr passieren könne. Vielleicht entschuldigen sich diese Charakterlumpen noch dafür, dass ein solches Sexmonster so lange völlig unerkannt sein Unwesen treiben konnte.
Aber nicht im Traum wird es ihnen einfallen, dass sie nur noch eins sind: lächerliche Hanswurste, in aller Erbärmlichkeit als Heuchler und Opportunisten ertappt. Eigentlich sollte nicht nur der Beschuldigte sich einen neuen Beruf suchen. Sondern sie alle auch. Das wäre endlich mal eine hygienische Reinigung des besudelten Journalismus.
Man darf ja noch träumen.