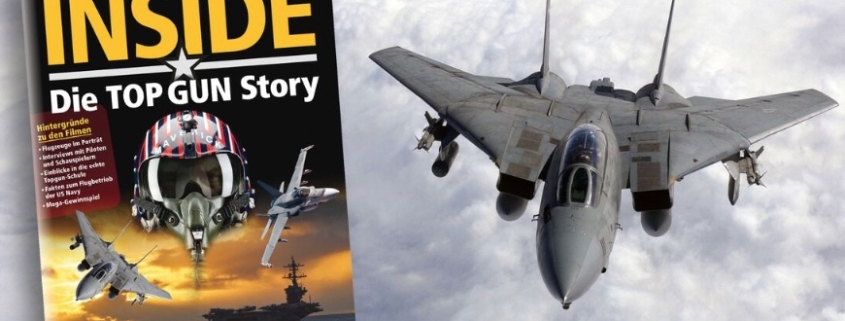Die Mechanik des Rücktritts
Ob Berset gehen muss oder nicht, hängt von einer Sache ab.
Es ist erstaunlich, dass all die Spin Doctors, die Krisenkommunikationsspezialisten, die teuer bezahlten Versager zum x-ten Mal und bei jeder Krise die einfache Mechanik eines drohenden Rücktritts nicht durchschauen.
Fingergehakel um Wissen oder Nicht-Wissen, schädliche Verbündete wie Jacqueline Badran, die sich mit ihrem üblichen Verve, aber ohne vertiefte Sachkenntnis in die Schlacht wirft, vorhersehbare Rücktrittsforderungen der SVP und des Mini-Megaphons Markus Somm.
Alles Nebensächlichkeiten. Zur Abteilung «es darf gelacht werden» gehören die Beteuerungen des «Blick»-Oberchefredaktors Christian Dorer und seiner ansonsten unsichtbaren Vorgesetzten Ladina Heimgartner (die Quotenfrau mit extrabreiter Visitenkarte), dass man dann völlig unbeeinflusst sei, im Fall, und niemals nicht Informationen des CEO Marc Walder verwendet habe. Der korrespondierte mit dem Departement Berset nämlich nur aus rein privatem Interesse.
Aber immerhin, Walder macht das einzig richtige: er schweigt. Das kann man von Tamedia nicht behaupten. Einerseits will man mit allen Fingern auf Ringier zeigen, andererseits will man klarstellen, dass man selber zwar auch von Indiskretionen profitiere, aber natürlich nicht so wie Ringier. Während dann noch der Politikchef Denis von Burg den Querschläger spielt und die ganze Aufregung um mögliche Amtsgeheimnisverletzungen und börsenrelevante Vorabinformationen als «Heuchelei» abkanzelt. Aber von Burg als Antidemokrat mit totalitärem Vokabular ist ein Fall für sich.
Währenddessen zeigt CH Media, wofür Journalismus gut ist. Man haut einen Skandal raus, und sobald die Wogen hoch und wieder runter gegangen sind, legt man nach. Gutes, altes Schulbeispiel, wie man eine Kampagne aufzieht und ein Thema am Köcheln hält: ja nicht gleich am Anfang alles verballern.
Die NZZ schliesslich schwankt etwas zwischen vornehmer Zurückhaltung, leisem Glucksen vom Spielfeldrand und fiesen Hieben, denn schliesslich ist Wahljahr. Und ein angeschlagener Berset, der sich durchschleppt, ist viel besser als ein zurückgetretener Berset.
Wovon hängt nun dieser Rücktritt ab? Wie immer, wie immer und überall von einer einzigen Sache. Kann man Berset eine Unwahrheit nachweisen oder nicht. Seit Barschels Ehrenwort (ältere Leser erinnern sich, ansonsten googeln) und auch zuvor gilt immer ein Prinzip. Jede öffentliche Figur, sei das in der Wirtschaft oder in der Politik, überlebt jeden Shitstorm, wenn nicht die eigenen Leute am Stuhl sägen. Oder wenn nicht nachgewiesen wird, dass eine Unwahrheit gesagt wurde.
Der letzte grosse Fall ereignete sich vor ein paar Jahren mit dem damaligen Präsidenten der Schweizerischen Nationalbank. Philipp Hildebrand geriet etwas ins Feuer wegen Vorwürfen des Insiderhandels. Die Debatte spitzte sich darauf zu, ob Hildebrands Frau ohne oder mit seinem Wissen Devisengeschäfte getätigt hatte. Seine erste Verteidigungslinie, dass er darin nicht involviert gewesen sei, brach zusammen, als sein eigener Anwalt vermeintlich zu seiner Entlastung weitere Dokumente vorlegte.
Zudem war Hildebrand von einem der üblichen Krisenkommunikationsfuzzis beraten. Die stellen meistens die Krise selbst dar, die sie zu bekämpfen vorgeben. Also geschah das Unvermeidliche: Hildebrand, zuvor Sunnyboy, Sympathieträger mit gewinnendem Äusseren und Auftreten, trat zurück.
Könnte, hätte, Fahrradkette. Aber dieser Rücktritt war garantiert vermeidbar, wenn man sich von Anfang an auf das banale Prinzip jeder Krisenkommunikation besonnen hätte. Was immer man gegen aussen sagt, gegen innen muss Kassensturz gemacht werden. Was trifft zu, was nicht, was kann belegt werden, was kann plausibel abgestritten werden.
Besonders der letzte Punkt ist heikel. Wir erinnern uns an den berühmten Satz des Schwerenöters im Oral Office: «I did not have sex with this woman.» Es brauchte die geballte Power einer der teuersten PR-Buden der Welt, um da noch die Kurve zu kriegen. Die genialische Idee: in den Südstaaten der USA gilt Oralverkehr nicht als Sex, also habe Bill Clinton nicht gelogen. Als sich dann auch noch seine Frau hinter ihn stellte, war die Präsidentschaft – trotz allen Bemühungen des politischen Gegners – gerettet.
Aus ähnliche Verwicklungen ist Bundesrat Berset bereits, nur leicht lädiert, herausgekommen. Auch ihm half, dass seine Frau grosszügig über den bekannt gewordenen Seitensprung hinwegsah – und dass Berset keine Unwahrheit nachgewiesen werden konnte.
Dafür braucht es auch eine klare Aussage, die widerlegt werden kann. Bei den vielen Kontakten zwischen seinem Kommunikationschef und dem Ringier-Verlag gibt es eine solche Aussage von Berset. Er habe davon nichts gewusst. Er habe vor allem nicht gewusst, dass hier möglicherweise vertrauliche, dem Amtsgeheimnis unterliegende Informationen weitergegeben wurden.
Das ist nun eine klare wahr/unwahr Situation. Kann man Berset über jeden vernünftigen Zweifel hinaus nachweisen, dass das so nicht stimmt, bleibt ihm nur der Rücktritt. Wir erinnern uns an den Fall der ersten Bundesrätin Elisabeth Kopp. Der wurde nicht ein Telefonat mit ihrem Gatten zum Verhängnis. Sondern seine Aussage («um Himmels willen, nein»), dass es nicht stattgefunden habe. Was nachweislich gelogen war.
Also dürfte die Entourage von Berset, also die wenigen Personen seines völligen Vertrauens, fieberhaft damit beschäftigt sein, alle schriftlichen Äusserungen (und heutzutage hinterlässt jeder ein Meer von SMS, WhatsApp-Nachrichten, Threema-Chats und E-Mails) zu durchforsten. Eine zentrale Rolle spielt auch der geschasste Kommunikationschef Bersets. Denn wenn einer weiss, ob sein Chef etwas wusste, dann er. Aber ihn hindert am Auspacken seine Schweigepflicht und das Amtsgeheimnis, das natürlich über eine Entlassung hinaus gilt. Um ihn zum Reden zu bringen, bräuchte es ein sehr verlockendes Angebot.
Wir fassen zusammen. Ob Berset zurücktreten wird oder nicht, hängt nicht vom Gebelfer der Medien ab. Auch nicht von neuen Enthüllungen. Sondern einzig und alleine davon, ob man ihn einer Lüge überführen kann oder nicht. On verra, wie der Welsche zu sagen pflegt.