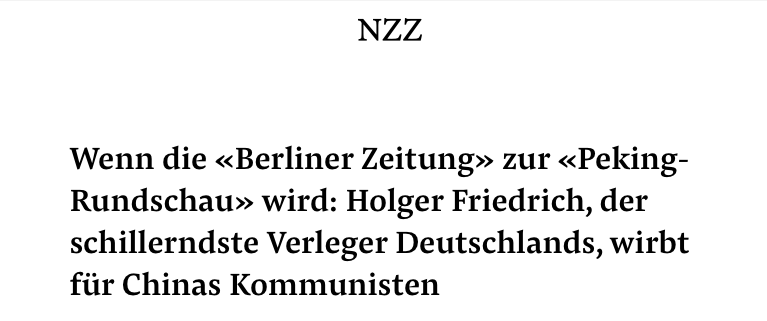Scharfrichter Scherrer
Der NZZ-Sittenwächter hat wieder zugeschlagen.
Geht’s drum, die Berichterstattung von anderen zu kritisieren, so im Roshani-Skandal, ist Lucien Scherrer mit harschen Urteilen schnell zur Hand. Die eigenen Fehlleistungen übergeht er dabei grosszügig.
ZACKBUM musste ihn schon scharf verwarnen:
Auch die beiden Autoren des NZZ-Artikels, Nadine Brügger und Lucien Scherrer, haben nicht mal den Anstand im Leib, auf einige Fragen von ZACKBUM zu reagieren. Schliesslich haben sie nicht nur Falschinformationen verbreitet, sondern auch unqualifizierte Angriffe auf Konkurrenzorgane oder Personen geführt. So behaupten sie, Canonica und Roshani hätten bis 2021 beim «Magazin» gearbeitet und Daniel Binswanger sei dort stellvertretender Chefredaktor gewesen. Ein einfacher Faktencheck hätte ihnen diese Peinlichkeiten erspart.
Im roten Bereich dreht Scherrer, wenn es gegen alles Rote geht. So wirft er der «Berliner Zeitung» vor, sie werde zur «Peking Rundschau». Denn ihr Herausgeber hatte sich zuschulden kommen lassen, an einer internationalen Konferenz in Peking teilzunehmen – und darüber objektiv zu berichten.
Sein neuster Ausflug in seinen Rotlichtbezirk gilt der Grazer Bürgermeisterin:

Schon im Titel bemüht er sich, das Schimpfwort «Putin-Versteherin» noch zu steigern. Denn so etwas darf es für Scherrer eigentlich nicht geben: «Als Kommunistin mit Herz ist Elke Kahr ein Medienliebling». Da schüttelt es Scherrer, und die NZZ verschwendet wertvollen Platz in ihrem Feuilleton, damit er mal so richtig vom Leder ziehen kann. Polemik ist ja gut, wenn man’s kann. Rüpeleien, Denunziationen und untaugliche Anspielungen sind’s hingegen nicht.
Die «Grazer Bürgermeisterin» falle «mit kruden Aussagen zu Russland auf», behauptet Scherrer. Sie sorge «in Österreich für Irritationen und empörte Reaktionen», behauptet Scherrer. Ja was hat sie denn Furchtbares getan? Sie hat ein interview gegeben und gesagt, dass sie sich nicht anmassen wolle, «darüber zu urteilen, wie Menschen in anderen Ländern leben und ihre Regierungen wählen». Bezüglich des Fehlens freier Wahlen in China sagte sie: «Ja, aber was ist die Alternative? China hat jedenfalls kein anderes Land überfallen und es geschafft, einem grossen Teil seiner Bevölkerung relativen Wohlstand zu verschaffen.»
Und schliesslich hat sie schon mehrfach Putins Krieg gegen die Ukraine scharf verurteilt, sagt aber auch: «Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine sei zwar eine Katastrophe, aber Sanktionen gegen ihn seien «nicht zielführend, weil sie immer die einfachen Menschen treffen». Österreich werde von niemandem bedroht, solange sich das Land entsprechend verhalte und niemanden angreife. Militärische Aufrüstungen in Europa dienten im Übrigen nur den finanziellen Interessen der Rüstungsindustrie.»
Über diese Aussagen kann man mit Fug und Recht geteilter Meinung sein, aus ihnen zu schliessen, Kahr sei eine «verkärte Putin-Versteherin», ist aber schlichtweg absurd, das ist verschwurbelter Unsinn eines Demagogen, der die Welt immer noch durch dicke Brillengläser einer vorgefassten, ideologisch gepanzerten Meinung sieht und aus der Schiessscharte seines Meinungsgerichtshofs losballert.
Dafür sind ihm auch Ausflüge in die ferne Vergangenheit nicht zu blöde: «Wie andere kommunistische Parteien in Europa war die KPÖ einst eine Aussenstelle von Stalins Sowjetunion. Sie bejubelte dessen Verbrechen, hielt auch nach dem Tod des «Führers» treu zu Moskau.»
Noch schlimmer: «ein KPÖ-Funktionär» sei «2021 im weissrussischen Fernsehen aufgetreten», ein «anderer Genosse» habe 2019 die «Volksrepublik Donezk» besucht «und mit Separatisten posiert». Was hat das alles mit Kahr zu tun? Eigentlich nichts, das fällt dann auch Scherrer in seinem Amoklauf auf:
«Kahr selbst hat sich in Interviews wiederholt von Stalin oder dem «russischen Angriffskrieg» in der Ukraine distanziert. Allerdings kann sie im nächsten Atemzug den jugoslawischen «Staatsmann» Josip Broz Tito preisen oder die französischen Kommunisten, die zu den treusten Vasallen Stalins gehörten und Überlebende des Gulag-Terrors als Faschisten verleumdeten.»
Was daran falsch sei, Tito als Staatsmann zu bezeichnen, der Jugoslawien zusammenhielt, erklärt uns Scherrer wieder nicht.
Ganz am Anfang seines Machwerks macht er aber klar, was ihm bei dieser angeblich «verklärten Putin-Versteherin» in den falschen Hals gerät: «Ihr Wahlsieg wurde sogar von der «Washington Post» vermeldet, und in Deutschland zeigten sich selbst bürgerliche Medien entzückt. «Willkommen in Leningraz», witzelte die «Frankfurter Allgemeine». … Die Oden galten Elke Kahr, die im September 2021 zur Bürgermeisterin der Stadt Graz gewählt wurde. Kahr ist Mitglied der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ). Diese hat 2021 in Graz fast 30 Prozent der Stimmen erhalten, wohl nicht wegen ihrer Ideologie, sondern weil sich die «Kuschel-Kommunisten» («Tagesspiegel») um Elke Kahr sympathisch und bürgernah geben. Sie spendet einen Grossteil ihres Magistratenlohns und präsentiert sich den Medien gerne als Sozialarbeiter im Dienste des Volkes, mit Zigarette im Mund und Brille im Haar.»
Grauenhaft, diese Österreicher. Wählen doch eine Kuschel-Kommunistin, die sich bürgernah «gebe» und dann noch einen Grossteil ihres Lohns spende, eine Idee, auf die Scherrer niemals käme.
Während er über kommunistische Parteien herzieht, blendet er die herausragende und opfervolle Rolle der KPÖ im Kampf gegen den Faschismus aus. In Österreich war sie an vorderster Front im Widerstand gegen Hitler, österreichische Kommunisten kämpften im Spanischen Bürgerkrieg auf der Seite der Republik. Ihr Eintreten für die Neutralität Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg brachte ihnen schon damals Beschimpfungen ein, die Kommunisten seien Landesverräter.
Als in der Schweiz die PdA noch eine politische Rolle spielte, sah die NZZ auch ständig rot, warnte vor der kommunistischen Gefahr, begrüsste das Verbot der Kommunistischen Partei der Schweiz im Jahre 1940, denunzierte Schweizer Kommunisten als Landesverräter, organisierte sogar die Pogromstimmung gegen den marxistischen Denker Konrad Farner, der mit seiner Familie am von der NZZ bekannt gegebenen Wohnsitz in Thalwil belästigt und bedroht wurde.
In dieser Tradition sieht sich offensichtlich der Kommunistenfresser Scherrer. Seine unqualifizierten Ausfälligkeiten gegen alles, was nicht in sein ideologisches Raster und seine Denkschablonen passt, senkt das Niveau der NZZ ungemein. Denn denunziatorisches Gewäffel ohne Erkenntnisgewinn steht diesem Blatt schlecht an, das sollte es den Kollegen von der Werdstrasse überlassen.