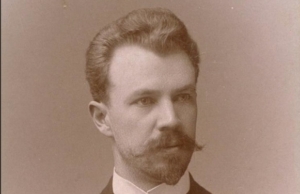Jekami mit Journis
Keiner zu klein, Meinungsträger zu sein.
Die Temperaturen steigen – und fallen wieder. So ist es ein ewiges Auf und Ab. Der Leser kann allerdings nur auf einer Metaebene Vergnügen und Unterhaltung aus den meisten Publikationen saugen.
Zu Prigoschin und Putin haben nun so ziemlich alle Meinungsträger, Experten und Spezialisten ihren Senf gegeben. Vielleicht fehlt noch die Meinung des Kopierers, des Staubsaugers und der Kaffeemaschine auf der Redaktion. Wir warten auf Exklusiv-Interviews.
Wunderbar ist auch, wenn sich im gleichen Organ sogenannte «Experten» diametral widersprechen. Bei CH Media schwafelte der eine von einem Militärputsch, der andere behauptet: «Prigoschins Coup war eine gut inszenierte PR-Operation, die in die Geschichte eingehen wird.»
Such’s dir aus, lieber Leser, kann man so oder so sehen.
In erhöhte Wallungen, geradezu in Vibrationsstatus hat die Medien ein klitzekleines Ereignis in einer klitzekleinen Kommune versetzt: «Erstmals in Deutschland hat die rechtsradikale Partei ein kommunales Spitzenamt erobert». Es gibt neu einen Landrat, der der AfD angehört. Die ist, trotz angebräunten Radikalinskis und Provokateuren wie Björn Höcke, eine demokratische Partei, und dieses Amt wurde in einer demokratischen Wahl erobert. So what? Aber der Tagi vibriert: «Die AfD setzt die Demokratie unter Spannung».
Anlass für homerisches Gelächter ist auch die Meldung: «Sek-Schülerinnen sprechen über die Menstruation». Denn: «Die kostenlosen Binden und Tampons, die neu in städtischen Schulhäusern aufliegen, seien aber erst ein Anfang.» Der Anfang vom Ende? Kurt Tucholsky (Kindersoldaten: googeln) sagte ganz richtig: «Die Frauen haben es ja von Zeit zu Zeit auch nicht leicht. Wir Männer aber müssen uns rasieren.» ZACKBUM regt an, ebenfalls kostenlos Rasierapparate und After Shave aufzulegen; verdammte Ungerechtigkeit.
Wie allerdings vermeldet werden kann, dass Tamara Funiciello nicht nur ein reines Frauenticket für die Nachfolge des Frauenverstehers Alain Berset anregt, sondern überraschenderweise auch sich selbst durchaus darauf vorstellen könnte, ohne dass dem Journalisten die Lachtränen in die Tasten getropft sind?
Wer herausfinden will, wie tief das «Magazin» gesunken ist, sollte sich hier davon überzeugen:

Das nennt man eine journalistische Implosion. Nicht in einer Millisekunde, aber in einem ganzen Heft. Da darf Christian Seiler doch tatsächlich grenzdebile Leserfragen beantworten. Kostprobe:
«Ich bin vor einem Jahr Mami geworden. Nun kommt es öfters vor, dass der Kleine genau dann Hunger hat, wenn ich zu kochen beginne. Das heisst, ich habe ihn dann auf dem Arm. Und da wird es dann schwierig mit Schnippeln Hast du ein paar gute (vegane) Rezepte, die man auch mit einer Hand in Windeseile zubereitet kann?»
Vielleicht sollte Seiler dem Mami erklären, dass vegane Ernährung zu Mangelerscheinungen führt (Vitamin B12, Vitamin D, Zink, Jod, Eisen), die dem Gedeihen eines Babys nicht förderlich sind, auch wenn man es auf den Arm nimmt. Stattdessen rät er zu einem schnippelfreien Gericht: «Mit dem Löffel essen und den Kleinen immer wieder kosten lassen.» Der arme Kleine.
Okay, jetzt muss aber ZACKBUM die Tastatur trocknen, haben wir gelacht.