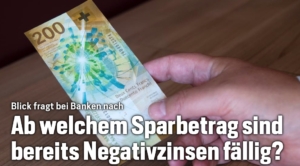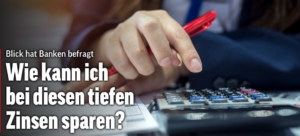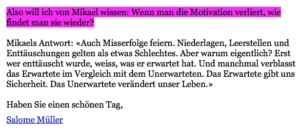«Blick» hat einen Leiter weniger
Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht?
«Dominik Stroppel verlässt die Blick-Gruppe», vermeldet persoenlich.com. Er war Leiter Video- und Audioformate. Die kamen besonders unter die Räder, als die CEO von Ringier Medien Schweiz verkündete, dass man – natürlich zur Qualitätssicherung – 75 Stellen kübeln werde. Nach Konsultationen wurde das dann auf 55 Stellen geschrumpft.
Sie sei froh und dankbar um die Reduktion des Stellenabbaus, sagte Ladina Heimgartner, und zerdrückte dann eine grosse Krokodilsträne: «Gleichzeitig ist das Bedauern gross, dass 55 Kolleginnen und Kollegen ihre Stelle verlieren und das Unternehmen verlassen werden.»
Immerhin, einer geht freiwillig. Mit einer Begründung, die tief blicken lässt: «Als sich der Stellenabbau im Videobereich der Blick-Gruppe konkretisiert und sich abgezeichnet hat, dass auch Mitglieder meiner Teams davon betroffen sein würden, habe ich mich entschieden, ebenfalls zu kündigen», wird Stroppel von persoenlich.com zitiert.
Der Mann kann was, und neben online ist Audio und Video bekanntlich eine sinnvolle und dringend nötige Ausweitung des Angebots eines Massenblatts wie dem «Blick». Wohl genau aus diesem Grund wurde beschlossen, «Blick TV» runterzufahren, zum Skelett abzumagern. Wie immer mit grossem Tamtam gestartet, Zukunft, rasant, Zusammenarbeit mit CNN, Wahnsinn, hier wird Internet-TV von morgen schon heute gemacht.
Dann verzwergte es zum üblichen Ringier-Flop. Wie fing’s an? «Morgen Montag, 17. Februar 2020, startet die Blick-Gruppe mit dem ersten digitalen Sender der Schweiz.» Das waren noch Zeiten: «Im Viertelstunden-Rhythmus sendet das digitale TV Informationen zu Politik, Wirtschaft, Sport und Unterhaltung.» So erschallten die Fanfaren im Februar 2020. Und Ende September 2023 war’s dann schon (fast) vorbei.
Management by error and error. Von try kann ja nicht wirklich die Rede sein, wenn man nach bloss dreieinhalb Jahren mehr oder minder den Stecker zieht. Das heisst ja auch, dass man es in dieser ganzen Zeit nicht geschafft hat, ein funktionierendes Businessmodell auf die Beine zu stellen. Genügend Zuschauer zu überzeugen. Querverwertungen zu schaffen. Also all das, was eigentlich eine Geschäftsleitung leisten sollte, bevor so ein grösseres Projekt auf die Rampe geschoben wird.
Aber ein mit Zwangsgebühren finanzierte Nischen-TV-Station zu leiten, das ist halt schon etwas anderes als in der freien Wildbahn unterwegs zu sein. Ringier brüstet sich damit, besonders woke, inklusierend, equal voice und so zu sein. Wie’s in der Realität bei Ladina Heimgartner aussieht, berichtet Peter Rothenbühler in der «Weltwoche»:
Mit den richtigen Beziehungen oder Voraussetzungen war brutaler Misserfolg bei Ringier noch nie ein Karrierekiller. Dagegen muss man resilient bleiben.