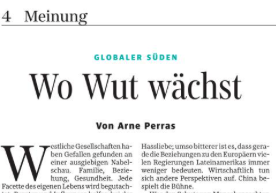Kornelius rettet die Welt
Wenn man ihn nur lassen würde …
«Stefan Kornelius leitet seit 2021 das Politik-Ressort der «Süddeutschen Zeitung» und schreibt in dieser Rolle auch für die Titel der Tamedia.»
Schreibt in dieser Rolle? Hat denn der Qualitätskonzern Tamedia keinen einzigen Redaktor, der diese Rolle spielen könnte? Dafür würde sich doch jeder Volontär eignen; irrwitziger als Kornelius würde der auch nicht schreiben.
Kornelius ist zunächst einer der bestvernetzten deutschen Journalisten. Mitglied der PR-Truppe «Atlantik-Brücke», im Beirat der «Bundesakademie für Sicherheitspolitik», der «Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik», usw. Wenn er schreibt, weiss man nie, wer ihm gerade die Feder führt.
ZACKBUM hat ihn schon als «Trumps allerschärfste Waffe» bezeichnet, denn wer solche Feinde hat, braucht eigentlich gar keine Unterstützer. Als «Verbal-Amok» quält er regelmässig die zahlenden Tamedia-Leser.
Zu seinen Lieblingsvokabeln gehören Aufforderungsverben. «Sollten, müssen, haben zu». Unablässig gibt er Anweisungen und Befehle. Unbeeindruckt davon, dass sie niemals ausgeführt oder umgesetzt werden. Wahrscheinlich verzweifelt er manchmal in seiner Schreibstube daran, dass die Welt so viel besser sein könnte, würde man nur auf ihn hören.
Aber das schreckt ihn nicht davon ab, einen aus wahltaktischen Gründen rausgehauenen Satz von Donald Trump für eine strenge Zurechtweisung aller zu missbrauchen. Von Beginn an lässt er keinen Zweifel daran, was er vom Präsidentschaftskandidaten hält, den das Weisse Haus als «unhinged» bezeichnet: «Das Übersetzungsspektrum reicht von «aus den Angeln gehoben» bis «irre» und beschreibt damit alles, was über den Mann zu sagen ist. Donald Trump ist von der Leine.» Ach, war er vorher angeleint?
«Wenn Trump bereits jetzt als Kandidat diesen Schaden anzurichten in der Lage ist – was erst wird er als Präsident tun?» Ja furchtbar, aber welchen Schaden hat der Mann denn angerichtet, ausser, den Blutdruck von Kornelius in ungesunde Höhen zu treiben? Na, nimm das, du Irrer:
«Trumps Bemerkung zum Nato-Bündnis, frivol leichtfertig dahingequatscht während einer Wahlveranstaltung auf dem Land in South Carolina, zeugt vom Irrsinn, der ihn umwölkt.»
Glücklicherweise für die Welt, also für die kleine Welt der Zwangsleser, entlarvt Kornelius Trump in seinem ganzen Wahnsinn: «Als wäre dies alles nicht dramatisch genug, geht Trump einen Schritt weiter und lädt Russland ein, «zu tun, was zum Teufel es tun will», sollten die Bündnisstaaten ihre Schulden an Amerika nicht begleichen.»
Zittere, Europa, denn was sind die Folgen? «Neun Monate reichen nicht aus, um die Nato, Europa und überhaupt die globale Sicherheitsarchitektur Trump-fest zu machen. Die europäischen Nato-Staaten sind dennoch gezwungen, mit dem plötzlichen Zusammenbruch ihrer Sicherheitsordnung zu rechnen. Wer sich heute nicht auf diese Gefahr vorbereitet, begeht ein historisches Versäumnis.»
Da sind aber die Regierungen in London, Paris, Madrid, Rom und Berlin froh, dass sie Kornelius vor einem historischen Versäumnis bewahrt. Nur, was sollen sie denn eigentlich tun? Da wird Kornelius erschreckend wolkig und schwammig: «Auch die tatsächliche Stärke Russlands und die strategischen Ambitionen Wladimir Putins zwingen zu einer nüchternen Bewertung der eigenen Sicherheit – und zu radikalen Entscheidungen.»
Nun gut, sagen die Regierungschefs Europas, aber Himmels willen, welche Entscheidungen sollen wir denn treffen? Da wird das Orakel, der grosse Ratgeber, der Mann mit Durchblick und Weitsicht, noch dunkler und unverständlicher:
«Der Mann, der am liebsten in den Spiegel schaut und sich selbst bewundert, hält allen anderen ebenfalls einen Spiegel vor. Es wird höchste Zeit, die Selbstbetrachtung zu beenden und zu handeln.»
Öhm, also Trump schaut am liebsten sich bewundernd in den Spiegel, hält ihn aber allen anderen vor. Wie geht das? Ein Wunderwerk der Spiegeltechnik, irgendwie. Aber wer betrachtet sich da eigentlich auch noch selbst, die europäischen Regierungschefs? Im Spiegel, den ihnen Trump vorhält, während er sich selbst, aber das wird nun wirklich kompliziert.
Aber stattdessen soll nun – höchste Eisenbahn – gehandelt werden. Aber was denn, wie denn, wo denn, womit denn? Kein Wunder, dass sich Kornelius sicherlich als männliche Kassandra empfindet; keiner glaubt seinen Weissagungen. Aber daran ist er selber schuld. Denn der Ratschlag «tu was» ist von solch abstrakter Inhaltsleere, dass ihn weder der Leser noch der Machthaber versteht.
Welch ein tragisches Schicksal: keiner versteht Kornelius. Schlimmer aber ist: der Tamedia-Leser zahlt noch dafür, dass er unter diesem Mumpitz leiden muss. Wie sagte da Bill Clinton so heuchlerisch wie richtig: «I can feel your pain». Aber es gäbe Abhilfe – wenn noch mehr Abonnenten handeln würden.