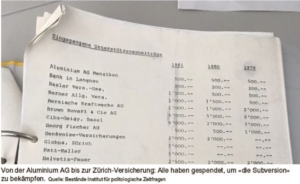Tagi -Qualität
Ein Jungredaktor verbockt einen Artikel. Er rutscht ins Blatt, durch alle Kontrollen.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Angeblich sollen fünf gnadenlose Kontroll- und Qualitätsprüfungen stattgefunden haben, bevor der Artikel «Sonja Rueff-Frenkel (FDP): Die Frau mit dem Spinnennetz» erschien.
Darin erlaubte sich Kevin Brühlmann einige fragwürdige Fragen und Bezüge auf orthodoxe jüdische Sichtweisen auf Frauen. Kann man so machen, sollte man nicht so machen.
Darauf erhob sich Protestgeschrei, und zweistufig krochen Oberchefredaktor Arthur Rutishauser und Pseudo-Co-Chefredaktorin Priska Amstutz zu Kreuze. Grosse Entschuldigungorgie, der sich auch der Autor anschloss.
Die Betroffene und Vertreter der jüdischen Gemeinde in Zürich zeigten sich davon befriedigt und wollten die Sache ad acta legen. Sie warnten sogar ausdrücklich davor, hier ein Exempel zu statuieren, weil die Probleme im Tagi wohl tiefergreifender seien, wenn ein solcher Text durch alle angeblich vorhandenen Kontrollinstanzen unbeschnitten rutschte.
Aber es wäre ja nicht das Qualitätsorgan Tamedia, wenn man sich nicht bemühen würde, die schlimmstmögliche Wendung zu finden.
Einem Journalisten fiel auf, dass Brühlmann bereits seit einer Woche nicht mehr im Impressum von Tamedia steht. Nach einigem Rumgedruckse räumte man ein, dass man sich inzwischen von Brühlmann «getrennt» habe, es habe immer wieder Differenzen bei der Auffassung gegeben, was Qualitätsjournalismus à la Tagi beinhalte.
Offenbar beinhaltet es, dass man sich dann doch, aber erst nach Tagen, vom Jungjournalisten trennte, auf Deutsch: ihn feuerte.
Damit verknüpft ist das mehrfache Lippenbekenntnis, dass man die Kontrollen und vor allem das Gegenlesen von Artikeln noch viel massiver implementieren möchte, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholten.
You’re kidding, wie da der Ami sagt. Was soll denn verbessert werden, wenn tatsächlich fünf Nasen den Artikel lasen und nichts daran auszusetzen fanden? Das ist doch schon mal die erste Bankrotterklärung.
In Hierarchien, die nicht nur klimgende Titel vergeben, sondern die auch an Verantwortung knüpfen, ist es völlig klar, dass der Verursacher eines Problems eine Mitverantwortung trägt. Noch grösser ist aber die Verantwortung der übergeordneten Kontrollinstanzen, die den Fehler nicht bemerkten, ihn zuliessen, ihrer Verpflichtung nicht nachkamen.
Die Entschuldigungsorgie wurde von Oberchefredaktor Rutishauser und Pseudo-Co-Chefredaktorin Amstutz unterzeichnet. Rutishauser hat die wenig beneidenswerte Aufgabe, bei rund einem Dutzend Kopfblättern nach dem Rechten sehen zu müssen. Also ständig Feuerwehrmann zu spielen, weil irgendwo immer Feuer im Dach ist.
Aber Amstutz hat ohne zu erröten diese Selbstbezichtigung unterzeichnet, dass diverse Kontrollinstanzen versagt hätten. Auf Deutsch: sie hat versagt. Ihr Mit-Co-Chefredaktor Mario Stäuble hat die Entschuldigung nicht mal mitunterzeichnet.
Weder von ihm, noch von ihr hat man bislang ein selbstkritisches Wort vernommen. Die zweite Bankrotterklärung. Erst auf dem Latrinenweg erfuhr die Öffentlichkeit davon, dass der Autor des Artikels gefeuert wurde. Keine Medienmitteilung, nichts. Erst nach einer Schrecksekunde räumte die Tamedia-Medienstelle ein, dass man sich getrennt habe. Wie, warum, fristlos, mit welcher Begründung genau? Da würde Transparenz für den Tagi offenbar zu weit führen. Dritte Bankrotterklärung.
Inzwischen soll die Redaktion, wird gemunkelt, ihr Befremden über diese Vorgehensweise ausgedrückt haben. Und, Traumtänzer, die sie sind, soll die Wiederanstellung von Brühlmann gefordert worden sein. Mehr wolle man aber öffentlich nicht sagen, wird verlautet.
Offenbar hat die Redaktion immerhin etwas vom Protestschreiben von 78 erregten Tamedia-Frauen gelernt, dass als interne Kritik etikettiert war, aber ohne Einverständnis aller Unterzeichnerinnen via Jolanda Spiess-Hegglin an die Öffentlichkeit gespült wurde. Wodurch mit diesem dubiosen Absender schon mal einiges an Wirkung verspielt wurde. Vierte und fünfte Bankrotterklärung.
Letztlich wird ebenfalls kolportiert, dass sich Big Boss Pietro Supino schon mehrfach über Artikel von Brühlmann echauffiert haben soll. Sollte das tatsächlich eine Rolle bei der Entlassung von Brühlmann gespielt haben, wäre das ein weiterer, eigentlich überflüssiger Beweis, dass die famose strikte Trennung zwischen Verlag und Redaktion ein müder Witz ist. Sechste Bankrotterklärung.
Frage: Wie oft können die wichtigsten Prinzipien eines seriösen, verantwortungsbewussten und ernstzunehmenden Journalismus an die Wand gefahren werden?