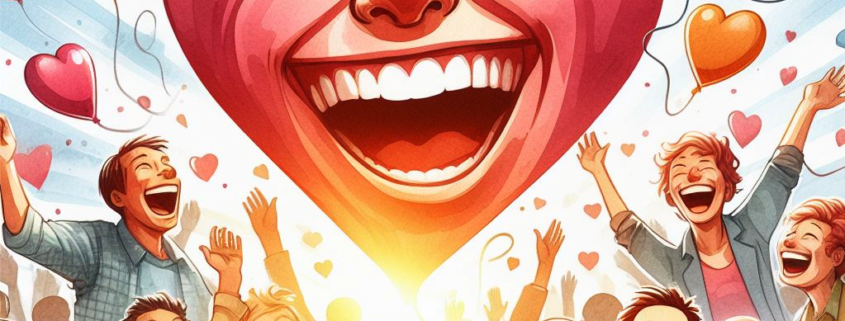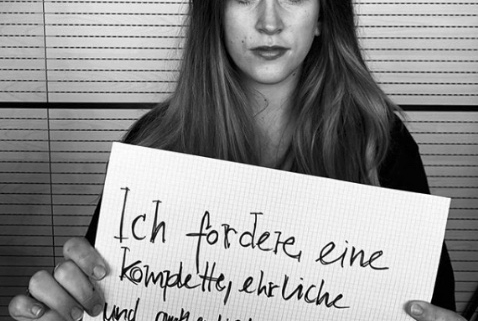Weltfrauentag und die Folgen
Vor drei Jahren protestierten 78 erregte Tamedia-Frauen.
Die Vorwürfe waren happig. Diskriminierung, Sexismus, anzügliche Sprüche, demotivierende Arbeitsatmosphäre. Überhaupt würden Frauen nicht ernstgenommen, der Redaktionsalltag sei ein Spiessrutenlaufen, vorbei an glotzenden, anzüglichen Männern. Furchtbar.
Dass Frauen auch fies sein können, bewiesen die beiden Initiantinnen des Protestschreibens. Sie flunkerten, dass der Brief für den internen Gebrauch sei und an Geschäftsleitung sowie Chefredaktion ginge. Dann händigten sie ihn hinterrücks der einschlägig bekannten Jolanda Spiess-Hegglin aus, die ihr übliches Geschrei anstimmte. Die meisten Unterzeichnerinnen waren nicht gefragt worden; Weiber halt, wen interessiert schon deren Meinung.
Garniert war das Schreiben mit über 60 angeblichen Vorfällen zwecks Illustration. Kleiner Schönheitsfehler: es fehlten jegliche Angaben, die eine Überprüfung ermöglichen könnten. Also eine reine Luftnummer. Dennoch zeigte sich Chefredaktion und Geschäftsleitung tief zerknirscht, ohne den Wahrheitsgehalt der Behauptungen auch nur analysiert zu haben.
Die zwei Initiantinnen holten sich ihre 15 Minuten Ruhm ab, die Mitunterzeichnerinnen schwiegen verkniffen auf jegliche Anfrage. Resultat: Raphaela Birrer hat Arthur Rutishauser als Oberchefredaktor abgelöst, eine Kerstin Hasse ist unsichtbares Mitglied der Chefredaktion.
Weiteres Resultat: kein männlicher Entscheidungsträger traut sich noch, einer Schreiberin zu sagen, dass ihr Text geholperter Schwachsinn ist. Weiteres Resultat: viele Pimmelträger verliessen Tamedia, da sie keinerlei Aufstiegschancen – ohne Geschlechtsumwandlung – mehr sahen.
Letztes Resultat: die angestrengte Untersuchung konnte keinen einzigen Fall verifizieren. Keinen. Nebenbei war die extra für diesen Zweck geschaffene interne Ombudsstelle kein einziges Mal kontaktiert worden. Niemals. Es ging also ausschliesslich um Effekthascherei, damit nicht nur die Initiantinnen trotz sackschwacher Performance eine ganze Weile unkündbar bleiben konnten.
All das merkt man den Organen von Tamedia bis heute schmerzlich an. Gendersprache, inkludierende Turnübungen, seitenlange Anleitungen, wie man die deutsche Sprache mit Sternchen und anderem Unfug vergewaltigen kann.
Den Mohrenkopf dabei nie vergessen.
Dieses Gekeife ist erbärmlich. Warum? Weil es ein Frauenproblem auf der Welt gibt, dem sich diese Frauenbewegung mit aller Energie und Kraft widmen sollte. Aber sprachliches Gehampel und Gestöhne und Gejammer hat einen Vorteil: es ist wohlfeil, strengt nicht an und verlangt keinerlei Einsatz.
Das Frauenproblem heisst Klitorisbeschneidung. Darunter versteht man die teilweise oder vollständige Entfernung, Verstümmelung der äusseren weiblichen Genitalien. Meistens ohne Betäubung, mit untauglichen Werkzeugen und unter bestialischen Schmerzen der minderjährigen Opfer. Die meisten der fürs Leben geschädigten Frauen sind zwischen 0 und 15 Jahre alt. Der Eingriff, oft auch noch ergänzt durch das Zunähen der Vagina, ist nicht rückgängig zu machen.
Weltweit leben geschätzt 200 Millionen Frauen, die dieser Tortur unterzogen wurden. Jährlich kommen 3 Millionen dazu, Tendenz steigend. Sie ist in Afrika verbreitet, in einigen Ländern Asiens sowie im Nahen Osten. Insbesondere Länder wie Somalia, Eritrea, Sudan, Ägypten, Guinea, Sierra Leone, Mali und Djibouti weisen hohe Beschneidungsraten auf.
Das ist kein Phänomen in weit entfernten, dunklen Gebieten der Welt. Auch in der Schweiz geht man von über 25’000 betroffenen oder gefährdeten Mädchen aus. In Somalia sind 98 Prozent aller Frauen beschnitten, in Äthiopien 74 Prozent.
Das ist das mit Abstand widerlichste, kriminellste und unmenschlichste Verbrechen gegen die körperliche Integrität, gegen die Sexualität einer Frau. Damit soll sichergestellt werden, dass sie beim Geschlechtsakt keine Lust empfindet und daher ihrem oft zwangsverheirateten Mann treu bleibt.
Es als kulturelle Eigenart zu verniedlichen, die man nicht eurozentristisch verurteilen, sondern respektieren sollte, ist neben der Befürwortung einer Burka wohl das Absurdeste, was kampffeministischen Kreisen eingefallen ist.
Es gibt nichts auf der Welt, was im Thema Frauenunterdrückung verabscheuungswürdiger ist. Und was tut die Frauenbewegung am Weltfrauentag dagegen? Nichts. Ausser vielleicht ein paar Lippenbekenntnisse absondern. Und sich dann wichtigeren Themen wie Genderlehrstühlen oder dem Kampf gegen die Männersprache zu widmen.
Das kann man (also Mann und Frau) doch nicht ernst nehmen.Genauso wenig wie Karriere nicht durch Kompetenz, sondern durch Geschlecht.Das sind dekadente Pervertierungen. Das hat den Charme des der später geköpften französischen Königin Marie-Antoinette unterstellten Satzes, als man ihr mitteilte, dass das Volk hungere, weil es kein Brot gebe: Dann sollen sie doch Kuchen essen.