Blick nach Norden: der «Spiegel» geht auf Springer los.
Was der Tamediamann fürs Rüpeln Philipp Loser an Konzernjournalismus gegen Hanspeter Lebrument bot, war zwar unappetitlich, aber alles ist relativ.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Zudem kroch der Niedermacher zu Kreuze, der entsprechende Artikel wurde aus den Archiven gespült. Was bleibt, ist ein schaler Nachgeschmack bis heute und die Frage, wieso Loser sich nicht einen anständigen Beruf gesucht hat.
Nun zeigt aber der «Spiegel» mit «Sex, Lügen Machtmissbrauch», was eine richtige Breitseite gegen die Konkurrenz ist. Als gäbe es in Deutschland nicht gerade ein paar wichtigere Themen, bietet das Magazin ganze acht seiner geschrumpften Redaktionscrew auf, um in einer Titelstory den Springer-Verlag niederzumachen.
 a
a
Wieder eine «Spiegel»-Affäre?
Der «Spiegel» machte mit seiner süffigen Story «Vögeln, fördern, feuern» diesen Frühling auf die Unart des «Bild»-Chefredaktors aufmerksam, Mitarbeiterinnen, die bereit waren, sich hochzuschlafen, diese Möglichkeit einzuräumen. Wahrscheinlich werden wir uns demnächst noch Opferstorys anhören müssen, obwohl keine der Damen bislang von den diversen Möglichkeiten Gebrauch machte, sich gegen ungewolltes oder sogar nötigendes Verhalten zu wehren.
Der «Bild»-Bolzen Julian Reichelt konnte noch den Erstschlag wegstecken, nachdem eine Untersuchung kein kündigungswürdiges Fehlverhalten ergab. Aber dann, so ist die Globalisierung auch im Journalismus, kaufte Springer den US-Politblog «Politico» für ein paar hundert Millionen. Damit kam das Medienhaus from Germany auf den Radar der US-Medien, und die grosse NYT widmete eine Investigativstory den Verhältnissen bei Springer, mit besonderer Berücksichtigung der offenbar anhaltenden Unart des «Bild»-Bosses, am Arbeitsplatz den Hosenschlitz nicht geschlossen zu halten.
Es gäbe genügend Merkwürdigkeiten zu berichten
Auch in Deutschland hatte ein Rechercheteam das untersucht, wurde aber vom Besitzer des Medienhauses zurückgepfiffen. Statt sich aber diesen merkwürdigen Vorfällen zu widmen, nimmt sich der «Spiegel» in bester Boulevard-Manier das nächsthöhere Ziel vor die Flinte. Diesmal geht es gegen den starken Mann, Mitbesitzer und Vorstandsvorsitzenden Mathias Döpfner.
Mit dem typisch launigen Einstieg wird geschildert, wie der angeblich wie «ein Sonnenkönig» nicht etwa Besprechungszimmer betrete, sondern er rausche «herein wie eine Erscheinung». Stimmt’s nicht, ist’s wenigstens gut erfunden wie legendäre Einleitungssätze im Stil: «Wütend griff Helmut Kohl zum Telefonhörer und wählte höchstpersönlich die Nummer von ...»
Nicht nur an den Mief von Kohl erinnere Springer, sondern der Verlag sei geprägt von «einem zügellosen Boys Club, der feststeckt im chauvinistischen Muff der Sechzigerjahre». Zack, Blattschuss.
Viel Neues ist der Recherchier-Crew nicht aufgefallen, aber vielleicht will sie sich auch – nach den Relotius-Erfahrungen – etwas zurückhalten. Da gibt es ein etwas unglücklich formuliertes Mail von Döpfner, in dem er gegen den «neuen DDR Obrigkeits Staat» ranzt.
Das pumpt der «Spiegel» dann auf zu
«eine erschreckende Aussage in vielerlei Hinsicht, verachtend im Ton und verzerrt in der Wahrnehmung, vor allem aber ist sie kein Ausrutscher».
Offenbar hat sich der «Spiegel» ziemlich spurlos vom GAU erholt, der noch viel schlimmer als Sexismus oder vielleicht merkwürdige Aussagen ist: dass es passieren konnte, dass ein hochgelobter Mitarbeiter über Jahre hinweg durch alle Kontrollinstanzen hindurch Storys faken, erfinden, aufbretzeln, zusammenlügen konnte. Weil er wusste, wie er das Narrativ, das der «Spiegel» gern hörte, bedienen konnte.

In Wirklichkeit: sagen, wie’s sein sollte.
Nun aber spielt «Spiegel» das jüngste Gericht: «Was genau treiben die da bei Springer? Haben die noch nie von #MeToo gehört?» Mangels handfester Fakten legt das Nachrichtenmagazin den Springer-Chef nun auf die Couch des Psychiaters und setzt zur Fernanalyse an, gestützt auf die altbekannten «erzählen viele, die ihn gut kennen» – aber alle zu feige sind, mit Namen aufzutauchen. Also ist gut raunen und rüpeln:
Döpfner auf der Couch der «Spiegel»-Psychoanalytiker
«Sein obsessiver Freiheitsglaube sei umgeschlagen in eine Art Staatsfeindlichkeit, die allzu konsequentes Regierungshandeln als Bevormundung und Gängelung der Bürger deute. Die Coronapandemie hat seinen Hang zu solchen Dystopien offenbar zur Manie werden lassen.»
Das soll im Verlag offenbar Tradition haben, denn schon der Gründer Axel Springer habe «zeitweise Wahnvorstellungen, in denen er sich für den wiedergeborenen Jesus hielt», entwickelt. Von seiner ersten Frau, nach den Nürnberger Rassegesetzen der Nazis eine Halbjüdin, ließ er sich 1938 scheiden.»
Dass Springer zeitlebens und tatsächlich obsessiv für die deutsche Wiedervereinigung und die Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen eintrat, worauf sich sogar jeder Mitarbeiter bis heute verpflichten muss, wird der Ordnung halber vermerkt, um dann wieder auf Reichelt loszugehen.
Den Auflage- und Bedeutungsverlust der letzten Jahrzehnte habe man mit Reichelt «erkennbar durch Lautstärke» wettmachen wollen. Ein kalter Krieger, Rabauke, Kriegsreporter halt, mit auch so seinen Ticks:
«Nach wenigen Tagen in der »Bild«-Redaktion begann er sich zu kleiden wie der damalige Chefredakteur Kai Diekmann».
Als Rechercheglanzleistung zitiert der «Spiegel» dann aus angeblichen Nachrichten des Chefredaktors an eine ungenannte Geliebte: «Ich will deinen Körper spüren.» Ob der Körper zur «Bild»-Mannschaft gehörte, darüber senkt der «Spiegel» das Redaktionsgeheimnis.
Warum liessen das so viele Mitarbeiterinnen über sich ergehen? Wagenburg halt, System der Angst, Boys Club, auch gegenüber einer von Döpfner beauftragten renommierten Kanzlei hätten sich Betroffene nur unter Zusicherung von Anonymität geäussert. Was dem «Spiegel» eigentlich auch klar sein sollte: man kann keinen Chef aufgrund anonymer Anschuldigungen feuern. Das machte den Protestbrief der 78 erregten Tamediafrauen auch zum Rohrkrepierer.

Auch der «Spiegel» steigerte sich ins Crescendo gegen Trump.
Der «Spiegel» ist stolz darauf, auf welches Niveau seine Recherchierkünste gesunken sind: «Ein SPIEGEL-Team sprach in den vergangenen Monaten mit einem halben Dutzend Frauen, die im Zuge des Compliance-Verfahrens befragt worden waren, sowie mit Vertrauten dieser Frauen, sichtete Hunderte Nachrichten auf Handys, Messengerdiensten und E-Mails und wertete Dokumente aus, um die Schilderungen zu überprüfen.»
Was kam dabei heraus? Nichts Handfestes, nichts Hartes, wie Boulevardjournalisten sagen. Nur Geraune und Werweissen: «Im Hause Springer sind die wildesten Spekulationen im Umlauf, was Reichelt gegen Döpfner womöglich in der Hand haben könnte, welche Geheimnisse die beiden teilen, welche Chatprotokolle noch in den Smartphones verborgen sind.» Also der übliche Klatsch oder Flurfunk, genau wie beim «Spiegel».
Die ganze Richtung des Springer-Bosses passt dem «Spiegel» nicht
Dann lässt der «Spiegel» die Corona-Maske fallen; ihm passt die ganze politische Richtung Döpfners nicht, der sich immer mehr zu einem Kritiker der deutschen Willkommenskultur entwickelte, die der «Spiegel» lange Zeit kritiklos unterstütz hatte. Dafür greift die Truppe zwei Sätze aus einem längeren Essay Döpfners heraus, um zu scharfrichten:
«Sätze, die im besten Fall nach Stammtischgefasel klingen, aber auch auf jedem AfD-Parteitag Applaus ernten würden.»
Gibt es sonst noch Gemeinsamkeiten zwischen Döpfner und Reichelt? «Auch Döpfner sammelt nackte Frauen, bei ihm hängen sie an der Wand, eine Kollektion von 350 Aktkunstwerken, von 8000 Jahre alten Artefakten bis hin zu zeitgenössischen Werken.» Das ist nun infam, der Vergleich.
Zähneknirschend muss der «Spiegel» allerdings einräumen, dass Döpfner seine inzwischen 20-jährige Karriere ganz oben nicht nur seiner besonderen Beziehung zur Springer Witwe Friede verdanke. Sondern auch seiner Fähigkeit, den Verlag radikal umzubauen und digital fit zu machen. Zu einer Anlageperle, die auch US-Investoren überzeugte. Springer gehört inzwischen zu 45 den New Yorker Investoren KKR und Partnern.
Dann wird noch der Nachfolger Reichelts kurz in die Pfanne gehauen, und die Titelschmierenstory endet mit dem Verdikt: «Der versprochene Kulturwandel bei »Bild« fällt also erst mal aus.»
Es gab Zeiten, als eine «Spiegel»-Titelstory die Benchmark für deutschen Journalismus war. Aber ein Mentalitätswandel fällt auch hier weiterhin aus.



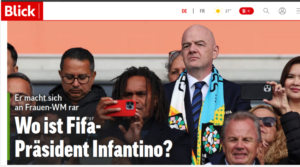










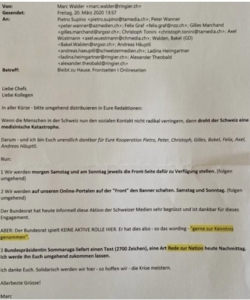








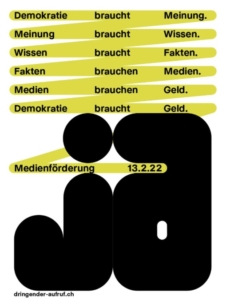





 a
a
