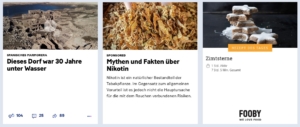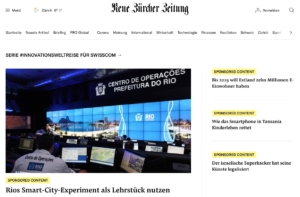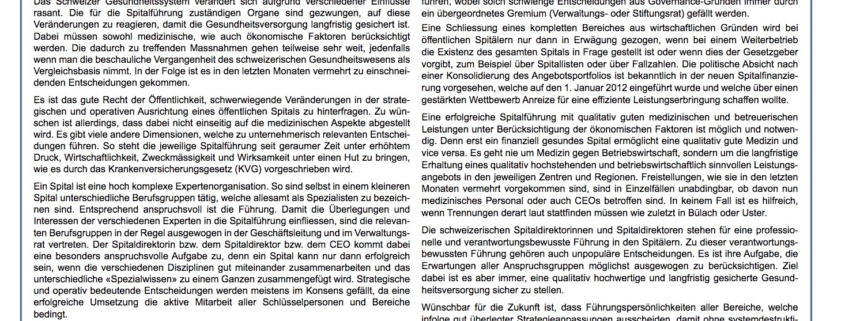Campax spinnt
Eine Lobbyorganisation ausser Kontrolle.
ZACKBUM musste sich schon mehrfach mit Grenzüberschreitungen dieser «Bürger*innenbewegung» befassen, die «seit 2017 Kampagnen zu den wichtigen Fragen unserer Zeit» führt. Edle Zielsetzung: «Wir wollen eine Gesellschaft, in der alle Menschen in Würde und Freiheit leben.»
Edle Ziele, schmutzige Methoden zur Erzielung. Duftmarke eins: «Nazi-Fratzen hinter der Folklore-Fassade: Die Freiheitstrychler haben bei der “Friedensdemonstration“ letzten Samstag auf dem Bundesplatz ihr wahres Gesicht gezeigt.»
Wenn ihnen der Inhalt eines Artikels nicht passt, wird gleich eine Beschwerde beim Presserat eingereicht und werden die höchsten Entscheidungsträger angebellt, Duftmarke zwei: «Deshalb fordern wir die Familie Coninx und Pietro Supino, den Verwaltungsratspräsident der TX-Group dazu auf, Massnahmen zu ergreifen, um den journalistischen Standard und die Qualitätssicherung der journalistischen Arbeit zu garantieren.»
Nun übertrifft sich Campax selbst, und das ist gar nicht so einfach. Ein Kampagnenleiter Urs ruft zu Spenden auf. Edles Ziel: «Zusammen verhindern wir den Rechtsrutsch!» Wie das? Indem die edlen Spender insgesamt 17’720 Franken aufwerfen sollen. Wofür? Für ein halbseitiges Inserat in der NZZ. Abgesehen von der Frage, ob die NZZ das Inserat überhaupt annehmen würde (wenn nicht, wird dann das Geld zurückbezahlt?): was soll da drinstehen?
Da hält sich «Urs» eher bedeckt. Die edlen Spender sollen für eine Black Box ihr Geld ausgeben. Vom mutmasslichen Inhalt gibt er nur bekannt: «Wissen die Menschen überhaupt, welchen antidemokratischen Kräften sie ihre Stimme geben, wenn sie FDP oder SVP wählen?»
Das ist ungeheuerlich. SVP und FDP sind die grösste und die traditionellste Partei der Schweiz. Sie sind in demokratischen Wahlen zu ihren Stimmen und ihrer Vertretung in Parlament und Regierung gekommen. Im Gegensatz zum «Kampagnenleiter von Campax Urs», der Geld dafür sammelt, um seinen undemokratischen Ansichten eine Plattform geben zu können.
Was ist der Anlass für diese Ausgrenzung?
«Hörst Du den riesigen Aufschrei darüber, dass die Junge Tat den Wahlkampf einer SVP Nationalratskandidatin koordiniert?1) Ich auch nicht. Und genau da liegt das Problem. Es wird immer normaler, dass rechtsextreme Kräfte in unserer Gesellschaft an Macht gewinnen. Diese antidemokratischen Kräfte und ihre Verbündeten werden etwa mit Listenverbindungen bis weit ins bürgerliche Lager normalisiert. Das ist eine Gefahr für unsere Demokratie.»
Campax-Urs bezieht sich dabei auf einen Artikel im «Blick». Sollte es zutreffen, dass eine SVP-Nationalratskandidatin auf einem aussichtslosen hinteren Listenplatz kommunikative Unterstützung der Organisation «Junge Tat» in Anspruch genommen hat, ist das ungefähr so bedenklich oder unbedenklich, wie wenn Campax ihr genehme Kandidaten unterstützt.
Natürlich kann man die politischen Zielsetzungen der «Jungen Tat», der SVP oder der FDP ablehnen, verurteilen, sogar als schädlich ansehen. Natürlich kann man einen Rechtsrutsch befürchten und sich dagegen wehren. Alles in einer Demokratie erlaubt, inklusive freie Meinungsäusserung.
Die hat aber auch ihre Tücken. Denn man ist auch frei darin, Unsinn, Schwachsinn, Entlarvendes zu brabbeln. So wie das Campax häufig tut. Der Organisation rutschen die Worte weg, sie wird keifig, schrill, merkt damit nicht, dass sie sich selbst den Boden unter den Füssen wegzieht.
Denn wer, der nicht völlig vernagelt ist, will schon für ein Inserat spenden, dessen Erscheinen ungewiss ist, dessen Inhalt unbekannt, und von dessen Stossrichtung man nur weiss, dass es SVP und FDP als «antidemokratische Kräfte» denunzieren will?
Bezeichnend: so grob Campax austeilt, so feig wird die «Kampagnenorganisation», wenn man ihr ein paar kritische Fragen stellt. Keine Antwort …
Wer etwas von Demokratie hält und sich als Demokrat sieht, zahlt dafür sicherlich keinen Rappen.



 Schon schwieriger, gell?
Schon schwieriger, gell?