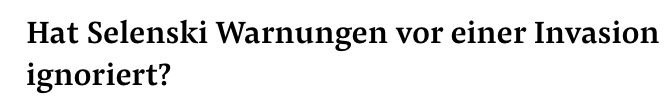Kratzer im Image von Selenskyj
Wieso liest man kritische Worte nur in der NZZ?
Wir müssen uns wiederholen, denn die NZZ wiederholt auch ihr Alleinstellungsmerkmal.
Das höchste der Gefühle an Kritik des ukrainischen Heldenpräsidenten besteht flächendeckend darin, dass er vielleicht zu forsch immer mehr Waffen fordert und zu ungestüm in NATO und EU will. Aber dass er eine direkte Konfrontation der Atommächte fordert und damit einen Dritten Weltkrieg riskiert, wird ihm nachgesehen.
Im Schwsarzweissfernsehen darf es keine Farbflecken geben. Gut ist gut, Held ist Held. Alles, was da stört, und das ist einiges, muss in den Hintergrund treten, denn Helden sind Helden, das ist in Comic-Verfilmungen so, das ist in der Darstellung der Mainstream-Medien so.
Pandora Papers, Millionenfonds im Ausland, gekaufte Präsidentschaftswahlen, Marionette eines ukrainischen Oligarchen, Zensur, Unterdrückung der Opposition, willkürliche Personalpolitik, undemokratische Entscheidungen – was soll’s, ein Held ist ein Held.
Nun blättert die NZZ kurz in die Zeiten kurz vor dem Überfalls Russlands zurück. Und geht der Frage nach, wieso der ukrainische Präsident nicht auf Warnungen vor einer bevorstehenden Invasion reagiert hat. Das wirft ihm kein Geringerer als der US-Präsident Biden vor. Und wird ausserhalb der NZZ mit Schweigen übergangen.
«Obwohl es klare Belege gegeben habe, habe auch Selenski sie «nicht hören wollen». Biden hatte unter Berufung auf die Erkenntnisse seiner Geheimdienste schon früh vor einem russischen Angriff auf die Ukraine gewarnt», schreibt Ulrich von Schwerin.
Noch Ende Januar hatte Selenskyj das als «Panikmache» verurteilt. Noch fahrlässiger: ««Wir werden im April Ostern feiern und dann im Mai wie üblich: Sonne, Ferien, Grillieren», sagte der frühere Fernsehstar am 14. Februar, der vor seiner Wahl zum Präsidenten 2019 versprochen hatte, den Krieg im Donbass durch Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu beenden. Seine Charmeoffensive war aber rasch gescheitert», führt die NZZ an.
Die ukrainische Armee habe dann allerdings viel effizienter und entschlossener Widerstand geleistet, als es von den russischen Invasoren erwartet worden war. Hingegen hatte Selenskyj versäumt, umfassende Zivilschutzmassnahmen rechtzeitig anzuordnen. «Allerdings bleibt die Frage, ob der Vormarsch der Russen im Falle einer frühzeitigen Generalmobilmachung nicht hätte eher gestoppt und der Verlust von Gebieten im Osten und Süden hätte verhindert werden können. Auch hätten womöglich viele Leben gerettet werden können, wenn bedrohte Städte wie Mariupol frühzeitig evakuiert worden wären.»
Es mag sein, dass das Rechthaberei im Nachhinein ist. Sicherlich schmälern solche Fehler nicht das Ansehen, das sich Selenskyj seit der Invasion erworben hat. Aber es mutet immer seltsamer an, wie Schweizer und deutschsprachige Medien sorgfältig alle dunklen Flecken auf einer weissen Weste übersehen. Da spricht man moderndeutsch von einem Narrativ, das sich durchgesetzt hat.
Aber genauso wenig wie alle Ukrainer zu guten Menschen werden, wenn sie flüchten, genauso wenig ist ihr Präsident eine reine Lichtgestalt. Nach wie vor absurd sind zudem alle Hoffnungen von Kriegsgurgeln, dass Russland in der Ukraine eine krachende militärische Niederlage zugefügt werden kann. All diese Mosaiksteine formen sich zu einem Bild, das fatal an die Frontberichterstattung während des Ersten Weltkriegs erinnert.
Da war auch, natürlich je nach Perspektive, die eine Seite angeführt von genialischen Feldherren und entschlossenen Führern, die von Sieg zu Sieg eilten, auch wenn ab und an schmerzliche Rückschläge eingeräumt werden mussten. Aber das waren nur Etappen auf dem sicheren Weg zum völligen Triumph, Der dann plötzlich für eine Seite zur völligen Niederlage wurde, was von der Bevölkerung fassungslos zur Kenntnis genommen wurde. Und nach Schuldigen und Ursachen rief, die mit den wahren Gründen nichts mehr zu tun hatten.
In Analogie dazu darf man gespannt sein, worin die moderne Dolchstosslegende vom Fall der Ukraine bestehen wird.