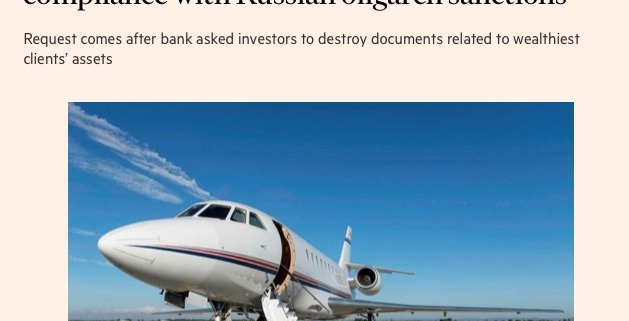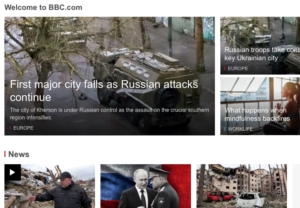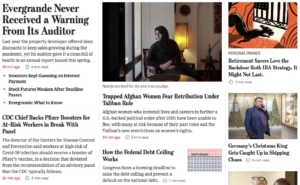Einfach NZZ
Keine Rezension, keine Kritik. Einfach ein Seufzer.
Wer die «Financial Times», den «Economist», den «Guardian», den «New Yorker», «Mother Jones» oder «The Atlantic» liest (die Liste liesse sich beliebig verlängern), ist bereichert und fühlt sich gleichzeitig elend.
Bereichert, weil das normalerweise (Ausnahmen gibt es immer) Qualitätsjournalismus auf hohem Niveau ist. Hier werden Themen durchdrungen, bearbeitet, komprimiert, in eine elegante Schreibe übertragen. Hier spürt man in jeder Zeile, dass der oder die Autoren viel mehr wissen, daraus dann das Wichtige extrahiert haben.
Ein gnadenloser Faktencheck und eine offensive Fehlerkultur garantieren, dass sich der Leser auf die Richtigkeit der Angaben verlassen kann. Die Interpretation der Wirklichkeit erfolgt selbstverständlich auch. Aber die Befindlichkeit der Autoren, die Nabelschau wird eher selten betrieben, es gehört sich nicht, den Leser damit zu belästigen.
Vor allem aber: hier herrscht Niveau. Sicher gab es vor allem in den USA Übertreibungen in der Berichterstattung über Trump, wird der Famlienclan von Präsident Biden bis heute unziemlich geschützt. Aber das sind kleine Flecke auf einer blütenweissen Weste.
Der deutschsprachige Journalismus dagegen ist weitgehend im Füdli, man kann es nicht vornehmer sagen. Wozu Beispiele aufführen, ZACKBUM ist voll von ihnen. Mediokres, Banales, Aufgepumptes, Skandalisiertes, dazu Ich, Ich, Ich, der moralische Zeigefinger, Rechthaberei, ein Telefon und zweimal googeln, fertig ist der Artikel.
Bildungslos, kulturlos, kenntnislos. Die Lektüre der drei Grosskonzerne, die die Schweizer Medienlandschaft mit unzähligen Kopfblättern im Tagesjournalismus beherrschen, ist eine Tortur, für die gar nicht genug Schmerzensgeld gezahlt werden kann. Gestolpertes, Gerülpstes, Unverdautes, Tiefergelegtes, künstlich Aufgeregtes, und immer penetranter: nicht berichten, sondern belehren. Nicht aufklären, sondern verklären. Nicht mit der Darstellung der Wirklichkeit ringen, sondern die eigene Weltsicht an einem Ereignis spiegeln.
Das ist furchtbar.
Aber es gibt einen Lichtblick. Auch darüber hat ZACKBUM schon einige Male geschrieben, auch kritisiert. Aber es ist hier eine subjektive, persönliche Erfahrung zu berichten, ein Blick aus dem eigenen Bauchnabel.
ZACKBUM hat um ca. 11 Uhr vormittags am 5. September 2023 die Homepage der NZZ aufgerufen. Und war informiert, amüsiert, auf Niveau wurden die Splitter der aktuellen Nachrichtenlage dargeboten, bekömmlich, aufbereitet, bedacht, selten, sehr selten aufgemaschelt, eigentlich nie kreischig. Nachdenken über den Frieden, hat Jositsch eine Chance, Touristen in Afghanistan, der Chef der Deutschen Bank (vielleicht eine Spur zu unkritisch, das Interview), gegen antiautoritäre Erziehung, Chinas Geisterstädte, die Rolling Stones singen noch, eine Ausstellung über die «Secessionen» in Berlin, ein nordkoreanischer Überläufer, die Massenschlägerei in Opfikon.
Und eine besondere Perle: im Feuilleton das Interview mit dem deutschen Journalisten und Autor Dirk Schümer. Ein wunderbarer Gedankenflug, die Fragen (knapp) auf der Höhe der Antworten, was für eine Bereicherung. Und in welche Abgründe blickt man dagegen bei den Schweizer Stammel- und Kreischautoren, denen der Titel Schriftsteller aberkannt werden sollte.
Nein, auch das ist kein «Paid Post», einfach die Entladung einer zu oft gequälten Seele …