Schnappatmung vor den Wahlen
Wäre es Le Pen geworden – Weltuntergang in den Medien.
Tamedia kriegte sich vor den französichen Präsidentschaftswahlen kaum mehr ein. «Sie will die Allianz des Westens sprengen», «Das zweite Gesicht der Marine Le Pen», «Eine Präsidentin Le Pen wäre für Putin ein Triumph». Das war schwer zu toppen, aber man probierte es: «In Frankreich entscheidet sich das Schicksal Europas». Und schliesslich: «Wie viele Warnschüsse braucht es noch? Was, wenn Marine Le Pen gewinnt?»
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Der «Blick» arbeitete gewohnheitsmässig mit dem grossen Hammer: «Sieg Le Pens wäre lebensbedrohliche Katastrophe», warnte ein «Frankreich-Experte». «Heute fällt Frankreich grundlegenden Richtungsentscheid», wusste das Blatt der tiefen Analyse am Wahltag. Hoffnung gab da nur eine «geheime» Wahlumfrage:
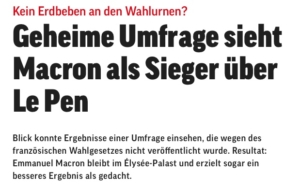
Auch CH Media wollte sich alle Optionen offenhalten: «Das Schreckgespenst war einmal. Warum Le Pen trotz allem gewinnen kann». Aber schliesslich konnte auch die Zentralredaktion aus dem Aargau Entwarnung geben: «Europa atmet auf: Macron gewinnt deutlich gegen die rechtsextreme Le Pen». Immer wieder gut, wenn nur einer der beiden Kandidaten ein Etikett angeklebt kriegt. Also «teflonartiger Macron gewinnt gegen rechtsextreme Le Pen», zum Beispiel.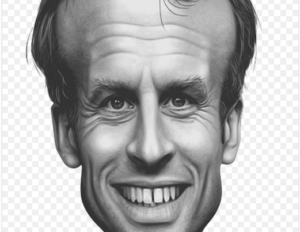
Auch das Blatt der Tiefenanalyse wollte sich nicht wirklich festlegen: «Frankreichs Politiker schliessen die Reihen gegen Le Pen – doch für Macron könnte es in der Stichwahl eng werden», unkte die NZZ noch am 11. April. Auch sie machte sich Sorgen: «Was ein Sieg Le Pens für Europa bedeuten würde». Ja was denn? «Das deutsch-französische Tandem würde an die Wand gefahren.» Aber auch die NZZ griff zu Alarmismus: ««Was Le Pen plant, kommt einem Staatsstreich gleich», lässt sie Juristen warnen. Aber auch hier findet es sich zum Happyend. Entweder haben CH Media und NZZ die SDA abgeschrieben, oder die alte Tante kam kongenial zum fast identischen Titel: «Grosse Erleichterung in Europa über den Wahlsieg von Macron».
Es konnte ja eigentlich kein vernünftiger Zweifel existieren, dass Macron gewinnen wird. Alleine die zusätzlichen Stimmen, die er vom linksradikalen Kandidaten kriegte, machten seinen Sieg klar. Während Le Pen nur die wenigen Stimmen von Éric Zemmour abstauben konnte. Der war zuvor auch als der noch grössere Gottseibeiuns und möglicher Kandidat für die Stichwahl hochgeschrieben worden.
Dabei schrumpfte er im ersten Wahlgang auf mickrige 7,1 Prozent, während der linksradikale Kandidat Mélenchon, den die meisten «Frankreich-Kenner» gar nicht auf dem Zettel hatten, mit 22 Prozent sogar knapp an Le Pen herankam und beinahe eine Sensation geschafft hätte.
Durch die krachende Fehlanalyse bei den vorletzten US-Präsidentschaftswahlen gewitzigt und vorsichtig geworden, wagte diesmal niemand eine klare Aussage. Selbst der mehr als wahrscheinliche Gewinn Macrons wurde immer in Frageform abgehandelt.
Dafür arbeitete man sich gewaltig an Le Pen ab. Obwohl sie eigentlich keine Chance hatte, konnte man mit ihr halt saftigere Schlagzeilen generieren als mit dem eher langweiligen Teflonpolitiker Macron, der wie beim ersten Mal eigentlich ohne Partei oder Parteiprogramm gewann. In Krisenzeiten hilft immer der Amtsbonus; selbst wenn der Wähler mit dem Präsidenten unzufrieden ist, will er mitten in der Flussüberquerung nicht die Pferde wechseln.
Also wäre Le Pen vielleicht Putins Triumph gewesen, aber Macron verdankt ihm zu einem guten Stück seine Wiederwahl. So verquer geht es in der Politik zu.
Als Absackerchen noch der Blick in die weite, ganz weite Zukunft, geworfen vom Frankreich-Kenner Peter Blunschi (man fragt sich, wo denn «watsons» Löpfe wieder steckt, wenn man ihn braucht): «Es geht für Präsident Macron dabei nicht nur um die Durchsetzung seiner Politik. Sondern auch um die Wahl 2027, wenn er nicht mehr antreten kann. Falls Macron scheitert, droht der Super-Gau: Eine Stichwahl zwischen der radikalen Linken und der extremen Rechten.» Wieso «watson» ein journalistischer Super-Gau ist, das kann man schon vor 2027 sagen. Wieso aber dannzumal eine Wahl zwischen links und rechts ein Super-Gau sein soll?


