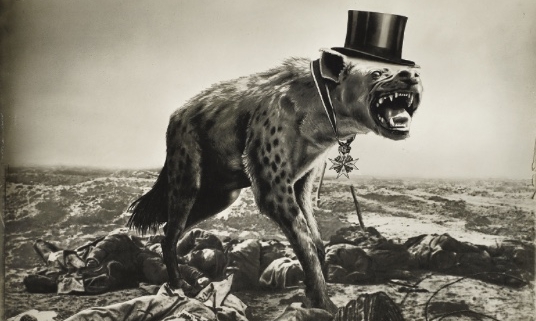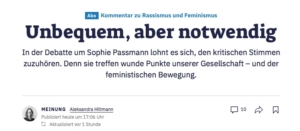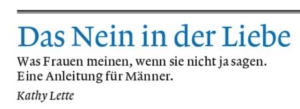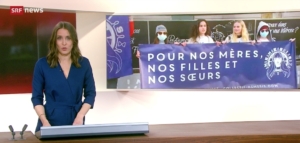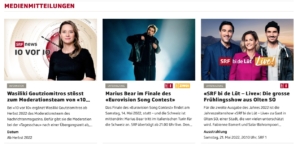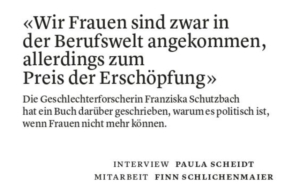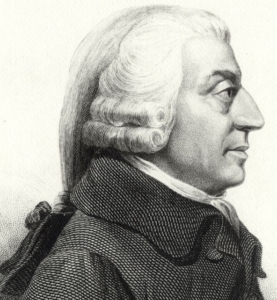Wumms: Fabienne Kinzelmann-Opel
Eine bedeutende feministische Stimme erhebt sich.
Kinzelmann-Opel ist ein journalistisches Schwergewicht. Ihre Selbstbeschreibung lässt kein Klischee aus: «Digital- und Print-Journalistin mit unternehmerischer Denkweise und redaktioneller Erfahrung in Deutschland, der Schweiz und den USA. Brennt für gutes Storytelling, mutige Ideen und dafür, Dinge nach vorne zu bringen.»
Inzwischen sei sie «internationale Korrespondentin» bei der «Handelszeitung». Ob die das weiss? Dort ist sie im Impressum einfach als Nummer zwei unter «Internationale Wirtschaft» aufgeführt.
Eigentlich müsste sie dort Chefredaktorin, wenn nicht Editor at Large sein, bei dem Vorleben: «Zuvor war ich die führende Auslandsredakteurin für Blick und SonntagsBlick, eine der größten Schweizer Tages- und Sonntagszeitungen. Ich schrieb Analysen, Porträts und Interviews für Print und Online, berichtete bei brisanten Themen live vor Ort oder analysierte im Studio und verantwortete kanalübergreifend die Auslandsberichterstattung mit einem besonderen Schwerpunkt auf den USA, Europa, dem Klimawandel und sozialen Bewegungen. Zudem entwickelte und schrieb ich einen eigenen Newsletter über US-Politik.»
«Führende Auslandredaktorin» beim «Blick» ist nicht schlecht; dabei hat sie wohl sich selbst geführt …
Zudem ist sie noch «Co-Präsidentin des Vereins Qualität im Journalismus». In dieser Eigenschaft röhrt sie auf «persoenlich.com»: «Missbrauchsfälle zeigen strukturelles Versagen». «Strukturell», das ist auch so ein Allerweltswort wie «resilient» oder «zukunftsfähig». Auf die Frage, was bei den «Corona-Leaks» schief gelaufen sei, rudert sie qualitätsvoll um die Wahrheit herum: «Die richtige Frage wäre gewesen: Hat ein Bundesrat ein einzelnes Medienhaus bevorzugt – oder schlicht sein Departement nicht im Griff? Stattdessen schoss die Branche auf sich selbst, besonders auf den Ringier-Verlag. Aus meiner Sicht war da viel Neid dabei. Ich habe damals selbst für die Blick-Gruppe gearbeitet und bin sicher voreingenommen, aber ich habe ja live mitgekriegt, wie die Kolleginnen und Kollegen gearbeitet haben, was für gute Kontakte sie geknüpft haben.»
So kann man das auch sehen. Und wie steht es mit den Affären um Christian Dorer und Werner De Schepper; zwei Mitarbeiter, die unter dubiosen Umständen abgesägt wurden? «Ich möchte mich nicht zu Einzelfällen äussern. Denn diese zeigen immer auch ein strukturelles Versagen: Es gibt ein Umfeld, das absichtlich oder unabsichtlich nicht genau hinschaut oder gewisse Verhaltensweisen akzeptiert oder sogar fördert.»
Ein strukturelles Versagen liegt hier wohl eher beim Management, das Karrieren ruiniert, ohne eine nachvollziehbare Begründung dazu zu liefern. Huldvoll verzichtete «persoenlich.com» darauf, Kinzelmann-Opel zu fragen, wie sie im Rahmen von strukturellem Versagen die Berichterstattung der «Blick»-Familie beispielsweise zum Thema Till Lindemann qualifizieren würde. Da musste der «Blick» schleunigst einen Artikel löschen und ein liebedienerisches Interview mit dem Anwalt des Rammstein-Sängers veröffentlichen. Das war sicherlich kein Ruhmesblatt des Qualitätsjournalismus.
Ebenso wenig wie dieses Watteinterview mit einer Angeberin …