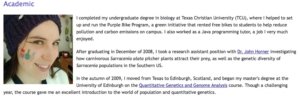Auslandberichterstattung ist leider auch hier immer mehr: Fantasieberichte aus gegendarstellungsfreien Räumen.
Die NZZ legte mit einem Schwachsinns-Artikel über Sansibar und Tansania, geschrieben am Schreibtisch in Zürich, das Niveau vor. Das unterbietet sofort eine Sandra Weiss aus Mexiko: «Kubanische Ärzte versklavt». Ferndiagnose aus Mexiko City. Dazu ist sie als «freie Korrespondentin» und Allzweckwaffe sicher kompetent. Immerhin schreibt sie für einmal nicht über Trump, China, Nordkorea oder andere Gegenden der Welt, von denen sie auch keine Ahnung hat.
Diesmal also Kuba, dieser Unrechtsstaat, diese Diktatur, wo das Regime Ärzte als Sklaven hält und in aller Welt vermietet. Es muss wohl seine Gründe haben, dass Weiss schon lange Einreiseverbot nach Kuba hat. Als langjähriger NZZ-Korrespondent dort weiss ich, dass man als ausländischer Journalist so ziemlich alles schreiben kann – ausser verlogenen Gesinnungsjournalismus und schlichtweg falsche Tatsachenbehauptungen.
In diesem Stil stellt Weiss ein paar absurde Behauptungen auf. Nach der üblichen Devise: kann doch keiner nachkontrollieren. Laut ihr leisten kubanische Ärzte seit Jahrzehnten Gesundheitsmissionen rund um die Welt. Das stimmt sogar, und es ist belegbare Tatsache, dass bei Naturkatastrophen, wo auch immer, ein Flugzeug mit vielen kubanischen Ärzten und eher wenig Ausrüstung gleichzeitig mit einem US-Flieger landet, mit nicht so vielen Ärzten aber Material satt. Und beide Teams arbeiten dann Hand in Hand, ohne ideologische Schranken.
Ausbildung von 10’000 Ärzten aus der Dritten Welt
Es ist auch eine belegbare Tatsache, dass Kuba den USA ernstgemeint humanitäre Hilfe anbot, als die Weltmacht nach einem Hurricane in New Orleans desaströs versagte. Zwei Flieger stünden abflugbereit auf dem Flughafen, sagte der damals noch lebende Fidel Castro, sobald sie eine Landeerlaubnis erhielten, würden sie sofort starten. Die USA schluckten schwer, waren 48 Stunden lang sprachlos und lehnten das Angebot dann entrüstet ab.
Durch Katrina starben in den USA alleine in New Orleans bis zu 1800 Menschen; die genaue Zahl ist heute noch nicht bekannt. Desaströs auch die Schneise der Verwüstung mit vielen Toten auf den grossen Antillen. Ausser auf der grössten Insel: Da starben haargenau 4 Menschen, und jeder einzelne Fall wurde von den kubanischen Behörden minutiös erklärt.
Es ist ebenfalls eine belegbare Tatsache, dass Kuba, durch alle Schwierigkeiten hindurch, jedes Jahr 10’000 Ärzte aus der Dritten Welt ausbildet. Gratis. Mit der Vorgabe, dass sie bitte in ihre Länder zurückkehren und nicht einfach woanders viel mehr Geld verdienen.
Das Gesundheitssystem auf Kuba hängt in den Seilen – ist aber gratis
Schliesslich ist es eine Tatsache, dass Kuba auch Ärzte vermietet. An Regierungen, die nicht so blöd sind, auf unnütze Entwicklungshilfe oder leere Versprechungen einer besseren medizinischen Versorgung in der Zukunft zu hören. Es ist ebenfalls richtig, dass diese Ärzte meistens in den abgelegensten Gebieten tätig sind, ohne Infrastruktur, ohne nichts. Aber als gute Notfallmediziner wissen sie sich auch ohne Tomografen oder High-Tech-Medizin zu helfen.
Zudem ist es eine Tatsache, dass auf der Insel selbst – zwar immer bettlägeriger – krampfhaft daran festgehalten wird, dass medizinische Versorgung gratis ist. Für alle. Ich selbst habe das kubanische Gesundheitssystem in Anspruch genommen, als Ausländer natürlich gegen Bezahlung. Man könnte vielleicht an der Ausstattung mäkeln, aber die Ärzte waren sowohl menschlich wie fachlich alleroberste Qualität.
Nun ist es tatsächlich so, dass Kuba den grösseren Teil der Bezahlung einbehält. Wie absurd der Vorwurf der Sklaverei ist, lässt sich leicht beweisen: diese Einsätze sind freiwillig. Es gibt immer mehr Gesuchsteller als Plätze. Ganz einfach deswegen, weil schlichtweg die Verdienstmöglichkeiten und vor allem die Chance, dringend benötigte Dinge (und auf Kuba wird so ziemlich alles benötigt) kaufen zu können und bei den regelmässigen Heimreisen mitzunehmen, einen solchen Einsatz begehrenswert macht. Und nicht zu wenige Ärzte mehr als einmal teilnehmen.
Aber natürlich gibt es unter den Zehntausenden von Ärzten auch solche, die den Auslandaufenthalt zur Desertion benützen. Und dann überraschenderweise nur schlimme Dinge über das Land sagen, das ihnen immerhin diese Ausbildung (natürlich auch gratis) und diesen Auslandeinsatz ermöglicht hat.
Realität? Ach was, niedermachen ist viel besser
Aus all dem könnte man den üblichen, mit der Realität höchstens zufällig Kontakt aufnehmenden Kuba-Artikel basteln. In der peinlichen Tradition seit 1990, dass immer mal wieder die letzten Wochen, Tage, Stunden, Minuten des Regimes heruntergezählt wurden. Unbekümmert darum, dass man über die Castros, ihre Revolution und den heutigen Zustand Kubas ganz verschiedener Meinung sein kann. Aber ein wenig mit der Realität sollte sie schon zu tun haben. Zum Beispiel damit, dass das Regime, ob es einem passt oder nicht, bis heute problemlos überlebt hat.
Nun zitiert Weiss die Behauptung von «Ökonomen», dass Kuba damit pro Jahr «zwischen sechs und elf Milliarden Dollar» einnehme. Wenn das wirklich Ökonomen sind, sollte man ihnen den Titel wegnehmen und dafür einen Taschenrechner schenken.
Wer kann rechnen? Dissidenten sicher nicht
Nehmen wir die von Vorzeige-Dissidentinnen wie Yoani Sanchez verbreitete Zahl von 30’000 Kubanern, die als medizinisches Personal in mehr als 60 Ländern arbeiten. Davon, was Sanchez natürlich nicht erwähnt, in 22 Ländern gratis.
Während sich neu an die Macht gekommene rechte Regierungen – so in Bolivien oder Brasilien – über die angeblich schlechte Ausbildung der kubanischen Ärzte beschweren, unterschlagen sie, dass es sich auch um medizinisches Personal handelt, und ein Pfleger oder eine Krankenschwester ist tatsächlich nicht so wie ein Arzt ausgebildet.
Abgesehen davon, dass in einigen Landesteilen Brasiliens die medizinische Versorgung mehr oder minder zusammenbrach, nachdem Präsident Bolsonaro – so verantwortlich handelnd wie sein Freund und Kollege Trump – auf einen Schlag alle kubanischen Helfer des Landes verwies: stimmt denn diese Zahl?
Nehmen wir die niedrigere Zahl, das versteht sicher auch eine NZZ-Korrespondentin. 6 Milliarden Dollar ist die Ansage. Bei einem – sagen wir grosszügig – Durchschnittsverdienst von 3000 Dollar im Monat, also 36’000 im Jahr, von denen nun unbestritten das Salär, Flüge usw. abgehen, also sprechen wir von gerundet 30’000, wären das – Moment, mein Rechner glüht – nicht mal eine Milliarde im Jahr.
Statt 6 bis 11 Milliarden sind es bloss 500 Millionen
Ziehen wir noch alle Gratis-Einsätze ab und nehmen wir ein realistisches Staatseinkommen bei medizinischem Fachpersonal von 20’000 Dollar im Jahr, ziehen wir noch konservativ 5000 ab, die Gratis-Einsätze leisten, sind wir bei 500 Millionen.
Da scheinen die Dissidenten, die «Ökonomen» und die jeden Quatsch abschreibende Korrespondentin eine Null – mindestens – dazugedichtet zu haben. Nicht das erste Mal in der NZZ; ich machte sie schon bei anderer Gelegenheit darauf aufmerksam. Man schrieb mir höflich zurück, dass ich recht habe und das nicht mehr vorkommen werde. Na ja.
Inzwischen hat noch die neue bolivianische Regierung ein paar Zahlen auf den Tisch gelegt. Ihr Vorgänger Morales habe für jeden in Bolivien eingesetzten Kubaner etwas mehr als 1000 Dollar bezahlt. Da diese rechte Regierung Morales überall eine reinwürgen will, wo sie nur kann, dürfte das stimmen. Dann sind es also nicht mal 3000 Dollar im Monat. Sondern eher 500, die beim kubanischen Staat hängen bleiben. Das wären dann noch; Moment ich frage bei den Ökonomen der NZZ nach, das wären dann noch 180 Millionen Dollar im Jahr.
Also liegt diese Schätzung nicht mal im erweiterten Streubereich der Wahrheit.
Verdient ein Arzt auf Kuba 60 Dollar im Monat?
Leider, verständlich, ist Weiss zwar in der Lage, ohne Kenntnisse der Zusammenhänge von Reuters abzuschreiben (die im Internet erhältliche kubanische Staatspresse ist ihr offenbar auch nicht zugänglich), dass es mal wieder «Wirtschaftsreformen» gebe. Wäre ein eigenes Thema. Aber, zu diesem Thema gehören noch zwei Dinge.
Ein Arzt auf Kuba verdiene umgerechnet 60 Dollar, behauptet Weiss. Offenbar ist ihr im fernen Mexico entgangen, dass es – ist ja auch erst anderthalb Monate her, eine Währungsreform auf Kuba gab. Die Binnenwährung CUC wurde offiziell abgeschafft, dafür die Saläre und Pensionen kräftig angehoben. So verdiente vorher tatsächlich ein Arzt auf Kuba um 1500 Pesos, was 60 Dollar entsprach. Inzwischen verdient er als Anfänger 7000 Pesos, was sich in den fünfstelligen Bereich steigert, wenn er an Erfahrung und Verantwortung zulegt.
Und wenn Weiss in den letzten Jahren mal Gelegenheit gehabt hätte, sich in Kuba etwas umzuhören (und nicht nur mit drei Dissidenten zu reden), dann wäre ihr vielleicht aufgefallen, dass es tatsächlich immer noch Ärzte gibt, und nicht zu wenige, die im Prinzip die gleiche, wahre Geschichte erzählen: Mein Vater war Analphabet, Zuckerrohrschläger. Und als ich ihm sagte, dass ich Arzt werde, meinte er ernsthaft, ob ich verrückt geworden sei, Menschen wie wir werden niemals Ärzte.
Menschen, die vorher niemals eine Chance hatten, Ärzte zu werden
Und diese Ärzte fahren dann fort: Ich sehe ja auch, dass diese Revolution viele, allzu viele ihrer Versprechen nicht eingelöst hat. Aber ich kann doch nicht einfach abspringen, flüchten, Taxi fahren. Schliesslich schulde ich dieser Revolution etwas. Oder wie das der scharfe kubanische Witz zusammenfasst: Hast du gehört, der Genosse Chefarzt ist wahnsinnig geworden. – Nein, wie äussert sich das denn? – Er schwatzt die ganze Zeit davon, dass er bald als Portier in einem Touristenhotel arbeiten wird.
Wie viel die Revolution oder das aktuelle Regime dafür verlangt, dass gratis Zehntausende von Ärzten ausgebildet wurden, ist die eine Sache. Dass laut offiziellen Angaben seit 1963 mehr als 400’000 Kubaner als Ärzte, als medizinisches Personal im Ausland arbeiteten, dort bezahlt oder gratis, darauf ist Kuba zu Recht stolz. Und die überwältigende Mehrheit dieser Ärzte würden es sich verbitten, von einer durch Gesinnung verblendeten, selbst den Grundrechenarten nicht mächtigen Journalistin als «Sklaven» abqualifiziert zu werden.
Denn sklavenartige Arbeitsverhältnisse auf Kuba endeten erst 1959. Und so ist es bis heute. Dass damit leider Rassismus nicht verschwand, ist ein anderes Kapitel. Aber so widersprüchlich ist Kuba, so sollte es auch dargestellt werden. Dann verschaukelt man nicht den Leser, der den Schwachsinn glaubt, der in der leider schwer nachlassenden NZZaS steht.
Das gilt übrigens auch für einen Dumpfsinnskommentar von Felix E. Müller. Dem ehemaligen Chefredaktor und aktuellem Bundesratstreichler.