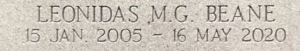Fehler? Niemals
Es herrschen Sitten wie weiland im Vatikan.
Wo gehobelt wird, fallen Späne. Irren ist menschlich. Fehler passieren. Es zeichnet das menschliche Streben aus, dass wir nicht unfehlbar sind. Das hat sogar der Papst eingesehen, und das will ja etwas heissen.
Ob der Journalist nun Gottes unerforschlichem Ratschluss auf der Spur ist oder ganz weltlich irgend etwas beschreiben, reportieren, erklären will: dabei passieren Fehler.
Wie man mit denen umgeht, das nennt man Fehlerkultur. Journalismus ist zunehmend kulturlos. Zumindest im deutschen Sprachraum. Im angelsächsischen hat jedes Qualitätsorgan eine eigene Rubrik, in der es pedantisch alle Fehler aufzählt, die passiert sind. Und korrigiert.
Eine in deutschen Medien unbekannte Rubrik. Halt, die «Zeit» führt immerhin den Blog «Glashaus», in dem sie ab und an sogar kritisch über begangene Fehler berichtet. Aber im Glashaus an der Werdstrasse, an der Falkenstrasse, an der Dufourstrasse und auch in Aarau sind solche Einrichtungen unbekannt, ebenso am Leutschenbach.
Nur wenn flächendeckend und offensichtlich Unsinn verzapft wird, rafft man sich knirschend zu einer Richtigstellung auf. Paradebeispiel in Deutschland ist die Schlagzeile «Karlsruhe verbietet NPD». Damit war gemeint, dass das deutsche oberste Gericht die bräunliche Partei NPD verboten habe. «Spiegel online», «Zeit», NZZ, ARD, Phönix, die Schlagzeile. Nur: das Bundesverfassungsgericht hatte lediglich die Verlesung des Verbotsantrags vermeldet.
Das sind dann jeweils Anlässe, «Abläufe und Arbeitsweisen» kritisch zu hinterfragen – und sich sogar mal zu entschuldigen. Aber die Lieblingsnummer der Medien ist immer noch: ups, aber wenn’s keiner öffentlich merkt, einfach drüber hinwegsehen, ist dann mal weg.
Besonders einfach ist die Fehlerkorrektur online. Wenn hier vorher «offline» stand: schwups, weg isses, hat doch niemand gemerkt. Und selbst wenn, wer macht schon einen Screenshot zur Beweissicherung. Der Deutsche Journalistenverband hat mal die Malaise schön zusammengefasst:
«Namen werden falsch geschrieben, Zitate unsauber wiedergegeben, Gerüchte für bare Münze genommen, Zahlen unsinnig interpretiert, Statistiken missverstanden oder Überschriften so zugespitzt formuliert, dass sie sachlich falsch werden.»
Wenn ZACKBUM das als eigen Formulierkunst verkauft und nicht als Zitat ausgewiesen hätte: wer hätte es gemerkt? Wer hätte den Absatz durch Google gejagt? Das unlautere Verwenden von Zitaten ohne Quellenangabe ist nicht ein eigentlicher Fehler, aber auch ein Zeichen der allgemeinen Sittenverluderung. Was in angelsächsischen Medien erschien, was im fernen Indien, in Indonesien, in Brasilien, in Südafrika publiziert wird, wer kennt das schon? Copy/paste plus Übersetzungsprogramm.
Besonders übel wird die mangelnde Fehlerkultur, wenn Betroffene eine Korrektur, eine Richtigstellung verlangen. Ist es nicht ein offensichtlicher Fehler (falscher Name, falscher Ort, falsche Tatsachenbehauptung) wehren sich die Redaktionen bis aufs Messer. Vorreiter dieses üblen Brauchs ist die «Republik», aber auch die grossen Medienkonzerne in der Schweiz betrachten die Forderung nach einer Korrektur als Beschäftigungsprogramm für ihre juristischen Abteilungen.
Viele werden schon damit abgeschmettert, dass eine Gegendarstellung einigen Formvorschriften entsprechen muss, die dem Laien nicht bekannt sind. Tun sie das, gilt dennoch meistens: ist nicht gegendarstellungsfähig, abgeschmettert. Beschreiten Sie doch den Rechtsweg, und viel Spass dabei. Wir hoffen, dass Ihnen unterwegs nicht das Geld ausgeht.
Im besten Fall erscheint dann ein Jahr später eine Gegendarstellung oder «Richtigstellung» oder ein «Korrigendum». Meistens hängt die rachsüchtige Journaille noch den Satz dran: «Die Redaktion hält an ihrer Darstellung fest.» Womit der Effekt gleich null wäre.
Auch sonst tun Redaktionen viel, um die Korrektur eines Fehlers zu vermeiden. beliebt ist beispielsweise, dem fehlerhaft Kritisierten die Möglichkeit zu geben, in einem Interview seine Position darzulegen. Der Leser fragt sich vielleicht, was das soll; es soll eine Gegendarstellung vermeiden. Ein anderes Mittelchen ist der anschliessende Lobhudel-Artikel.
Nur ganz selten wird’s richtig bitter und teuer in der Schweiz. «Ringier entschuldigt sich bei Borers» war so ein Fall. Da musste Michael Ringier höchstpersönlich auf der Frontseite zu Kreuze kriechen:
«Auch Herrn Dr. Thomas Borer und seiner Frau stand eine Entschuldigung zu. Sie haben beide Ungemach erlitten, was ich bedaure. Wir haben uns bei ihnen entschuldigt. … Wir haben uns auch verpflichtet, für den finanziellen Schaden, welcher dem Ehepaar Borer-Fielding entstanden ist, aufzukommen. In langen Gesprächen konnte auf dieser Basis eine einvernehmliche Lösung im Interesse aller Beteiligten gefunden werden.»
Lange Gespräche ist gut. Normalerweise wird so etwas in der Schweiz mit einer Zahlung im vier- oder höchstens fünfstelligen Bereich beigelegt. Hier war der Betrag siebenstellig, weil dank der US-Staatsbürgerschaft von Frau Borer auch ein dortiger Gerichtsstand möglich gewesen wäre. Und US-Gerichte kennen keine Gnade bei der Festlegung von Schadenersatz wegen Persönlichkeitsverletzung.
Aber all das ist keine Fehlerkultur, sondern knirschendes und erzwungenes Nachgeben.
Neu im diesen Theater ist die «Gewinnherausgabe». Damit ist gemeint, dass das Opfer einer Persönlichkeitsverletzung auf dem Zivilweg verlangen kann, dass durch diese Verletzung entstandener Gewinn herausgegeben werden muss. Hört sich einfach an, ist aber in Wirklichkeit sauschwer. Denn wie misst man diesen Gewinn? Zurzeit läuft da ein Pilotprozess, bei dem die Vorstellungen des Opfers und die Wirklichkeit massiv auseinanderklaffen.
Durch die Monopolisierung des Tageszeitungsmarkts sind die Möglichkeiten einer korrigierenden Gegenmeinung sowieso fast inexistent. Tamedia und CH Media behaupteten am Anfang, dass sie sich ihres gesellschaftlichen Auftrags durchaus bewusst seien und sich selbstverständlich als Podiumszeitungen verstünden, in denen auch Gegenmeinungen durchaus ihren Platz hätten. Völliger Unsinn, wie ZACKBUM schon ausgetestet hat.
Probiert man’s, bekommt man selbst von einem zugewandten Redaktor die Rückmeldung: fantastisch geschrieben, aber du meinst doch nicht etwa, dass ich das an der Redaktionskonferenz vorbringen könnte.
Löbliche Ausnahme, das muss erwähnt werden, ist die «Weltwoche». Hier darf man sogar den Chefredaktor, Besitzer und Verleger in den Senkel stellen, wenn man’s kann. Oder man stelle sich eine kritische Kolumne vor, in der in der NZZ Eric Gujer, bei CH Media Patrik Müller, bei Tamedia Raphaela Birrer oder im «Blick» Christian Dorer, oh, Pardon, der ist ja weg, also Gieri Cavelty, hops, auch weg, also irgend ein Chief oder Head kritisiert würde.
Nein, kann man sich nicht vorstellen. Aber eigentlich macht nur die Kontroverse, die Gegenmeinung, die Korrektur eine Lektüre spannend. Doch Papiermangel, Geldmangel, Ideenmangel, das Glaskinn der Mimosen, die sich Journalisten nennen, die miefigen Gesinnungsblasen ohne Frischluftzufuhr, die von oben vorgeschriebenen Leitlinien, denen jeder zu gehorchen hat, obwohl sie natürlich nicht schriftlich festgehalten wurden, all das trägt dazu bei, dass die Lektüre der Tagespresse so oft schlichtweg mieft.