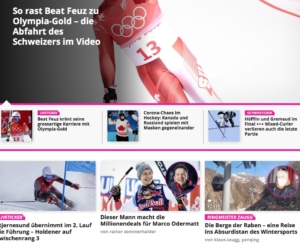«Die Ukraine muss siegen.» Und wie wird’s wirklich?
Beim Blick in die Zukunft herrscht weitgehend Einfallslosigkeit. Geboren aus Schwarzweissdenken kann man sich Prognosen nur in Schwarzweiss vorstellen. Dadurch wird das Zerrbild der Gegenwart in die Zukunft extrapoliert.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Da aber ein militärischer Sieg der Ukraine doch allgemein als unwahrscheinlich gilt, wird halt gerudert. Der Heldenpräsident Selenskij wird unbedingt mit allen nötigen Waffen versorgt, um den russischen Invasoren möglichst schmerzlich Widerstand leisten zu können – und sie zu guter Letzt aus dem Land zu werfen.
Das führt zwar zu bedauerlichen Kollateralschäden in der ukrainischen Bevölkerung und Infrastruktur, zu unermesslichem Leid und Zerstörung, aber die Alternative wäre nur, wie das ein Historiker in unnachahmlicher Dummheit behauptet, dem Präsidenten zu raten, er solle aufgeben.
Und das wiederum würde den Appetit des wahnsinnigen Verbrechers im Kreml stimulieren, der sich anschliessend noch Transnistrien, vielleicht Moldau, warum nicht Polen unter den Nagel reissen will. Deshalb muss der zur lokalen Militärmacht abgerüstet werden, was dadurch gelingt, dass möglichst viel von seinem Kriegsgerät vernichtet wird.
Das zukünftige Ziel muss unbedingt sein, dass die territoriale Integrität der Ukraine erhalten bleibt und sich Russland völlig zurückzieht, auch von der Krim. Anschliessend wird die Ukraine in die EU und die NATO eintreten, womit weitere Überfälle durch Russland ausgeschlossen sind.

Weiter im rosaroten Bild
Als Zeichen der europäischen Solidarität werden nicht nur Waffenlieferungen getätigt und geschenkt, es werden auch bedingungslos ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Die Schweiz sollte angesichts besonderer Umstände nicht so zickig auf ihrer Neutralität bestehen. Immerhin hat sie sich allen Sanktionen angeschlossen und nimmt auch freiwillig wohl bis zu 200’000 Flüchtlinge mit dem Sonderstatus S auf.
Die werden von der Schweizer Bevölkerung begeistert empfangen, wie nie zuvor zu Hause aufgenommen und fast als Familienmitglieder akzeptiert. Schliesslich handelt es sich um Miteuropäer, hochqualifiziert und überwiegend weiblich, meistens von einer kleineren oder grösseren Kinderschar begleitet. Dem entsprechenden Ansturm muss natürlich das Schul- sowie das Sozialsystem der Schweiz gewachsen sein. Ein Unmensch, der da von Kosten und Sekundärfolgen in der reichen Schweiz spricht.
Sobald der Endsieg über Russland errungen ist, werden grössere Teile der Flüchtlinge wieder in die Ukraine zurückströmen, so wie das ja auch bei den Ungarn und den Tschechen der Fall war. Der Wiederaufbau des Landes wird zu grossen Stücken durch beschlagnahmte Vermögenswerte reicher Russen im Ausland finanziert, zudem muss sich natürlich Russland daran beteiligen.
Als Gegenleistung hat die Ukraine schon versprochen, dass sie dann die letzten Reste von Korruption, Oligarchenherrschaft, pseudodemokratischen Veranstaltungen, willkürlicher Machtausübung beseitigen wird. Selbst Präsident Selinksij wird mit gutem Beispiel vorangehen und seine Millionenbesitztümer im Ausland offenlegen, vielleicht sogar verkaufen, um das Geld dann zu spenden.
Das ist der märchenhafte Ausblick des Mainstreams. Die Wunschvorstellung aller kalten Krieger und Kriegsgurgeln, die dafür grosse Teile der aktuellen Wirklichkeit einfach ausblenden.

Zurück in die realistische Zukunft
Denn das alles wird natürlich nicht passieren. Ein realistisches Zukunftsbild sieht so aus: als ersten Schritt wird es einen Waffenstillstand geben. Umso schneller, desto besser für die Zivilbevölkerung der Ukraine. Danach werden Verhandlungen beginnen, ohne Vorbedingungen. Wie vom Altmeister der amoralischen Realpolitik Henry Kissinger – und nicht nur von ihm – bereits skizziert, werden diese Verhandlungen damit enden, dass die Krim und die beiden Donbass-Provinzen russisch bleiben, sowie ein Landzugang zur Krim. Die Ukraine wird zumindest auf absehbare Zeit nicht in die NATO eintreten und höchstens den normalen, zeitraubenden Weg in die EU einschlagen.
Da Russland mehrfach wortbrüchig geworden ist, was seine Versprechen betrifft, die Grenzen der Ukraine anzuerkennen und zu respektieren, wird die territoriale Integrität der Ukraine von der NATO garantiert werden. Diese Kröte muss Putin schlucken, der sich ohne Not in eine Position manövriert hat, in der er nur verlieren kann. Die Frage ist nur, wo die Schwelle zum für ihn erträglichen Verlieren liegt.
Die anfängliche Begeisterung über und die Solidarität mit ukrainischen Flüchtlingen wird – wie bei früheren Flüchtlingswellen mit Willkommenskultur und allem – schnell nachlassen. Beispiele von Missbrauch, von Ausnützen, von Betrug, von Unwilligkeit, sich zu integrieren und auch bescheidene Angebote zu akzeptieren, werden zunächst als fremdenfeindliche SVP-Propaganda denunziert, sickern aber zunehmend in die öffentliche Meinungsbildung ein. Wie meist hat hier «Inside Paradeplatz» ein feines Näschen für die Vorboten zukünftiger Entwicklungen.
Die Belastungen der Schweizer Solzialsysteme werden diskutiert, die Bevorteilung von Flüchtlingen gegenüber notleidenden Schweizern kritisiert. Absurde Forderungen wie die, dass in der Schweiz Sondersteuern für sogenannte Kriegsgewinner erhoben werden sollen, deren Ertrag dann der Ukraine zugute kommen muss, fachen die kritische Debatte zusätzlich an.
Eine Wende wird sich immer deutlicher abzeichnen
Viele Familien, die gutgläubig Plätze angeboten haben, werden sich immer lautstärker darüber beschweren, dass sie versprochene Unterstützung nicht erhalten und stattdessen im Stacheldraht von Behörden und Bürokratie verröcheln, bzw. selbst in gröbere finanzielle Probleme geraten.
Die Meinungsträger, die von jeglichem Nachgeben abraten und die ewigen schiefen Vergleiche mit dem Appeasement gegenüber Hitler ziehen, werden zunehmend verstummen. Insbesondere, da Russland, in die Ecke gedrängt, immer unverhohlener mit dem Einsatz von zumindest taktischen Atomwaffen droht. Und immer deutlicher macht, dass es die Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte mit westlichem Militärgerät als Annäherung an eine direkte Intervention der NATO in der Ukraine empfindet.
Immerhin sind die Dummschwätzer verstummt, die noch vor Kurzem die Errichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine, garantiert durch die NATO, oder gar ein direktes militärisches Eingriffen des Bündnisses forderten.
Es gibt die Zukunftsprognose, die auf der fantasievollen Weltsicht beruht: wenn Wünsche wahr werden. Es gibt die Zukunftsprognose, die sich nach einer heilen, gerechten, moralisch intakten Weltvorstellung ausrichtet. Es gibt die Zukunftsprognose, die in typisch eurozentristischer Selbstfixierung davon ausgeht, dass die ganze Welt nicht nur den Einmarsch verurteilt, sondern auch bei wirtschaftlichen oder politischen Sanktionen gegen Russland dabei sei. Dabei stehen hier den europäischen Staaten plus USA, Japan, Australien und Neuseeland die überwältigende Mehrheit von über 150 Nationen gegenüber, die sich in keiner Form an Sanktionen beteiligen. Darunter Schwergewichte wie China und Indien.
Medien machen immer wieder die gleichen Fehler
Auch das Denunzieren von realistischen Zukunftsprognosen als zu nachgiebig, feige, gar als Ausdruck der Übernahme russischer Positionen, als Einladung für den Kreml, weitere Eroberungszüge zu riskieren, ist unnütz. Damit werden zwar weiterhin die Mainstreammedien bespielt, aber die machen den gleichen Fehler wie in ihrer Berichterstattung über die Pandemie.
Eine zu einseitige, zu meinungsstarke, zu wenig faktenbasierte, ausgewogene und umfassende Berichterstattung stösst den Konsumenten ab. Muss er dafür noch bezahlen, fragt er sich zunehmend, welchen Gegenwert er in Form von Einheitsbrei, ewig gleichen Kommentaren, markigen Kriegsrufen und unablässigen Verurteilungen Russlands bekommt.
Wie bei der Pandemie übergehen die Mainstreammedien gefloppte Prognosen kleinlaut. Die russische Wirtschaft wird demnächst zusammenbrechen. Der Rubel wird ins Bodenlose fallen. Russland wird schwerste Verluste mit seinen Rohstoffexporten erleiden. Die russische Bevölkerung wird in zunehmendem Leidensdruck beginnen, massiv gegen ihre Regierung zu protestieren. Der Veretdigungsminister ist abgetaucht, vielleicht schon abgesetzt, oder im Straflager. Oder liquidiert. Putin ist nicht nur wahnsinnig, sondern auch krank. Geschwächt. Innerhalb des Kremls wird bereits über seine Nachfolge nachgedacht. Nur ein ausgeklügeltes Sicherheitsdispositiv hat bislang verhindert, dass ein erfolgreiches Attentat verübt wurde.
Früher gab es die journalistische Berufsgattung des Kremlastrologen. Das waren die Kenner und Spezialisten, die aus kleinsten Anzeichen (wer steht wo bei Paraden, hustet der Generalsekretär, wieso wurde das Politbüromitglied schon seit zwei Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen) die ganz grossen Linien zogen. Nur war damals der Ruf der Medien noch viel weniger als heute ramponiert.
Neben Putin steht nun allerdings schon der zweite Verlierer eindeutig fest. Wieder einmal die sogenannten Qualitäts- und Bezahltitel, die für gutes Geld schlechte Ware liefern.