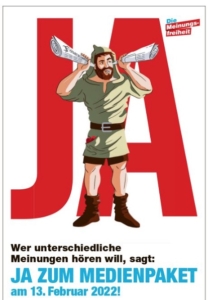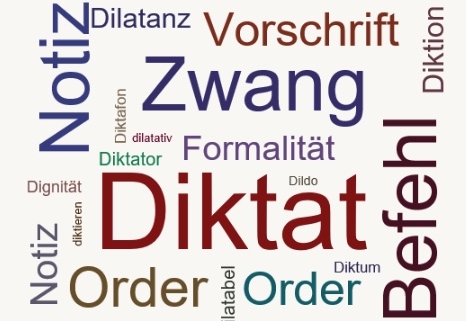Das Mies-«Magazin»
Ein Schatten, der Schatten eines Schattens von früher.
Die Geschäftsleitung von Tamedia attestiert dem «Magazin» doch tatsächlich «hervorragende Leistungen». Das ist ungefähr so realitätsnah, wie wenn man einen Artikel aus «20 Minuten» für den Pulitzer-Preis vorschlagen würde.
Denn eine der publizistischen Höchstleistungen von Finn Canonica, dem im Feuer stehenden ehemaligen «Magazin»-Chefredaktor, bestand bekanntlich darin, einen eisernen Sparkurs durchzuziehen, den die Mehrheit der Redaktion mit Kündigung beantwortete (freiwillig oder unfreiwillig). Keine eigenen Reportagen mehr, ein paar Kolumnen und billig Eingekauftes. Das wurde die neue Blattmischung.
Wir wollen hier nicht nostalgisch an frühere Glanzzeiten des «Magazin» erinnern, sondern aus gegebenem Anlass einfach die aktuelle Ausgabe anschauen.

Diese Arbeit ist ziemlich schnell erledigt, das Blatt umfasst noch gerade 32 Seiten. Da muss haushälterisch vorgegangen werden, schon seit Längerem ist das Editorial oberhalb des kurzen Inhaltsverzeichnisses reingequetscht.
Diesmal ist es von einer geradezu brüllenden Komik, wenn auch unfreiwillig. Es beginnt mit der Nacherzählung einer Kurzgeschichte von Alfred Döblin, die den Autor zur Selbsterkenntnis führt: «Vermutlich ist das schlechte Gewissen gegenüber den Kreaturen um uns herum, die wir schlechter behandeln, als es unser Weltbild erlaubt, den meisten nicht fremd, mir jedenfalls nicht.»
Allerdings meint er mit der Klage, «dass wir zu anderen gemein sind, obwohl wir doch eigentlich das Beste wollen», nicht die Zusammenarbeit auf der Redaktion. Sondern diese Ausgabe nimmt sich (wieder einmal) die alte Frage vor, wie es denn wäre, wenn Tiere «ähnliche Rechte besässen wie wir Menschen». In Basel scheiterte vor Kurzem eine entsprechende Initiative krachend; in ihrem Umfeld wurde diese Frage ausreichend diskutiert.
Hier schreckt aber die Autorin offenbar nicht vor einem geschmacklosen Vergleich zurück: «Jene, die den Gedanken (an Tierrechte, Red.) lächerlich finden, erinnert Svenja Beller an einen Gerichtsprozess in England vor 250 Jahren, als vor einer ungläubig lauschenden Zuhörerschaft ein Richter erstmals einem Sklaven Personenrechte zusprach.»
Dieser Stuss wird hier vor einer ungläubig lesenden (und zahlenden) Kundschaft dargeboten.
Auf Seite 4 kolumnieren dann Philipp Loser und Nadine Jürgensen. ZACKBUM weiss sich des Applauses seiner Leser sicher, wenn wir darüber einfach kein Wort verlieren. Oder doch, nur ein Satz: «Wir drei Gründerinnen von elleXX sind allesamt auch Mütter.» Inzwischen darf hier jeder (und jede) Schleichwerbung für alles machen …
Dann kommt Kochkenner Christian Seiler zu Wort. Der hat auch schon in so ziemlich alles ausser in einen Michelin-Reifen gebissen, also fällt ihm nur noch eine Verneigung vor der Sardelle ein, «diesem ebenso ungewöhnlichen wie unterschätzten Schwarmwesen».
Dann kommt wie angedroht die Verneigung vor dem Tier (das eine Seite vorher noch gewissenlos gefressen wird). Aber Beller weiss: «Schon bald werden wir zurückblicken und uns dafür schämen.» Nimm das, Christian.
Auf der Ebene Illustration erreicht das «Magazin» Tiefen, die zuvor nicht für möglich gehalten wurden. Es serviert seinen Lesern nämlich einen Rüssel. Auf einer ganzen Seite:

Rüssel eines unbekannten, wohl rechtlosen Elefanten (Screenshot «Magazin»).
Über 8 Seiten erstreckt sich diese Tier- und Leserquäleri, nur kurz unterbrochen von der neckischen Frage «Porsche oder Ferrari?». Mit dem nochmals ganzseitigen Schlussbild kann sich ZACKBUM jeden weiteren Kommentar ersparen:

Da greift sich selbst der Schimpanse an den Kopf (Screenshot «Magazin»).
Die gute Nachricht zwischendurch: mit dem Interview zur Frage «Wie hält man das weltweite Artensterben aus?» sind wir bereits halb durch. Auch hier schaffen ganzseitige Bilder wenigstens Luft für den geplagten Leser:

«Wenn ein Baum gestorben ist, trauern dann die anderen Bäume um ihn?»
Original-Bildlegende …
Auch die nächste Bildlegende hinterlässt tiefe Spuren beim Leser: «Die Bäume verdursten, und wir schauen weg. Ist der Mensch in Bezug auf Pflanzen und Tiere ein Soziopath?» Vielleicht sollten sich diese Frage mal Tamedia-Mitarbeiter über sich selbst stellen …
Noch ein Interview mit den beiden Gutmenschen Milo Rau und Wolfgang Kaleck. Dem Leser schlafen schon beim Titel beide Füsse ein: «Sie wollen nicht weniger, als die Welt verändern». Wie fängt der Text an? «Krieg, Ausbeutung, Ungerechtigkeit sind die grossen Themen …» Spätestens hier schliessen sich die Augen den Füssen an.
Auf Seite 30 eifert dann Max Küng den anderen Kolumnisten nach. Da es keinen neuen Pfister-Katalog zu betexten gibt, schreibt er über das Velofahren. Genau, diese «Zahlenpoesie» ist viel besser als Schäfchenzählen.
Wobei, es lockt noch das Kreuzworträtsel der unverwüstlichen Trudy Müller-Bosshard. Aber dann hat das «Magazin» ein Einsehen mit den Lesern. Halt, nicht ganz, mangels Inserenten prangt auf der Rückseite ein Eigeninserat des Hauses, das sich nun auch nicht jedem Leser erschliesst:

ZACKBUM ist sich sicher: das ist eine heimtückische Kritik am «Tages-Anzeiger». Der schreibt offensichtlich von Montag bis Samstag Unbegreifliches, was dann erst am Sonntag erklärt werden kann.
So gemein …