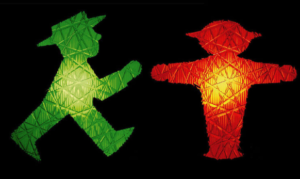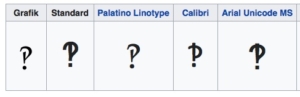Wo bleibt die Bööggin?
Keine dummen Scherze mehr in geschlossenen Veranstaltungen.
Wer meint, er könne im engeren Freundeskreis angeheitert oder nüchtern sexistische, rassistische, exkludierende, postkolonialistische Vorurteile transportierende Scherze machen: aufgepasst. Trägt das jemand dem Qualitätskonzern Tamedia zu, dann steht nicht nur der Böögg im Feuer, sondern auch der Scherzkeks.
Es gehört zum Brauchtum, dass vor der Verbrennung des Winters die Zünfter sich in geschlossenen Veranstaltungen bespassen. Wenn man entre nous ist und der Alkohol nicht rationiert wird, kommt es zu gewissen Enthemmungen. Das ist völlig normal und erlaubt. Weder bei solchen Gelegenheiten noch im eigenen Schlafzimmer muss man damit rechnen, dass Geschehnisse an die Öffentlichkeit gezerrt werden.
Ausser, man engagiert den falschen Kameramann. Dann passiert Folgendes: «Der Vorfall wurde von dieser Redaktion publik gemacht.» Das liegt immerhin im Streubereich der Wahrheit; «diese Redaktion» veröffentlichte Material, das nicht für die Veröffentlichung bestimmt war und ihr zugespielt wurde. Und regte sich fürchterlich über den Inhalt auf:
«In der zweiten Hälfte des dreiviertelstündigen Showblocks betritt ein Mann die Bühne, dessen Gesicht schwarz angemalt ist. Er trägt eine schwarze Kraushaarperücke, einen Bastrock und hält einen grossen Knochen in den Händen.»
Falls jemandem die Widerwärtigkeit dieses Auftritts nicht klar sein sollte: «Das wird in der Fachsprache Blackfacing genannt. Die Kritik daran: Privilegierte Personen machen sich über eine Gruppe lustig, die in der Gesellschaft Diskriminierung erfahren hat.»
Gnadenlos fährt der Tagi in seiner Rekonstruktion fort: «Neben dem Geschminkten stehen ein als Frau verkleideter Mann mit blonder Perücke sowie eine Frau ganz in Schwarz und mit Federschmuck. Während des Gesprächs steckt sich der schwarz angemalte Mann den Knochen zwischen die Beine. Lacher im Publikum.»
ZACKBUM resümierte damals: Merke: wer Blackfacing macht, ist nicht wirklich lustig. Wer sich darüber erregt, ist wirklich lächerlich.
Die Tagi-Redaktoren David Sarasin, Jan Bolliger und Corsin Zander waren damals ausser sich und hofften auf einen Riesenskandal: «Das ist mehr als bloss ein misslungener Scherz. Damit schaden sie Zürich – das Sechseläuten hat noch immer eine Ausstrahlung weit über die Stadtgrenzen hinaus.» Aber ein paar Monate später mussten sie frustriert vermelden: «Skandal-Auftritt am Zunft-Ball: Blackfacing am Sechseläuten hat keine juristischen Konsequenzen».
Damit versanken die Herren erschöpft in tiefer Weinerlichkeit und Betroffenheit. Deshalb übernimmt nun Sascha Britsko: «Zürcher Zünfte wollen nicht mehr diskriminieren», titelt sie. Womit sie unterstellt: Früher wollten die das? Sonst schreibt sie Meldungen zusammen oder verbreitet harte Kritik an allen Diversanten, die doch der Ukraine tatsächlich Verhandlungen empfehlen, Titel «Sind Sie noch ganz bei Trost?»
Nun aber kehrt sie ins Lokale zurück. «Die Zünfte haben neu einen Leitfaden gegen Diskriminierung». Auch das hat sie nicht selbst rausgekriegt, sondern sie zitiert in guter Sitte und Tradition das «Regionaljournal» von SRF. Gut so: «Damit wolle man gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Sexismus vorgehen, sagt das ZZZ dem «Regionaljournal»», echot Britsko.
Damit folgen die Zürcher Zünfter den Basler Fasnächtlern, welch seltene Kollaboration. «So steht im Leitfaden beispielsweise, dass diskriminierendes Verhalten wie Beschimpfungen nicht zum Geist des Sechseläutens passe». Damit ist ZACKBUM vollumfänglich einverstanden. Beschimpfungen müssen nicht sein.
Allerdings will das Zentralkomitee der Zürcher Zünfte (ZZZ) seinen «Leitfaden» nur als Empfehlungen verstehen: «Wir können und wollen nicht befehlen, sondern einzig empfehlen, damit das Sechseläuten weiterhin ein fröhliches und von kommerziellen und politischen Einflüssen unabhängiges Fest bleibt», lässt sich der Mediensprecher des ZZZ zitieren.
Apropos Diskriminierungen. Dass lauter Männer auf Pferden, die nicht um ihr Einverständnis gefragt werden, um einen brennenden Holzstoss herumreiten, wobei auch mal einer auf den Latz fällt, dabei komische Fantasieuniformen tragen und furchtbar wichtig tun: ist das vielleicht nicht diskriminierend? Und wenn zuvor jemand so geschmacklos ist, sich ein Baströckchen anzuziehen und das Gesicht schwarz anzumalen, ist das wirklich diskriminierend?
Nehmen wir mal an, ein Tagi-Redaktor findet es lustig, seine Angetraute nach vielen Ehejahren damit zu überraschen, dass er im Schlafzimmer den wilden Schwarzen gibt, ist das diskriminierend? Das ist vor allem etwas, was die Öffentlichkeit schlichtweg einen feuchten Dreck angeht.
Denn peinlich in diesem ganzen Umzug ist ausschliesslich der Tagi, der diesem Pipifax eine ganze Reihe von Artikeln widmet – und sich nicht bewusst wird, wie er sich Mal um Mal damit lächerlich macht.
Dabei ist die wahre Diskriminierung gar nicht adressiert, wie man heutzutage so schön sagt. Da sollten sich alle Beteiligten spontan unwohl fühlen und in sich gehen, dass ihnen das nicht aufgefallen ist.
Wie heisst die Figur schon wieder, die Jahr für Jahr verbrannt wird? He? Böögg. Genau. Und welches eindeutig zugewiesene Geschlecht hat diese Figur? Genau, DER Böögg. Dass das auf Alemanisch auch noch Popel bedeutet, macht es auch nicht besser, denn es ist DER Popel.
Der wie männlich. Wie exkludierend. Mehr als die Hälfte der Menschheit fühlt sich hier nicht vertreten. Zudem trägt der Böögg noch eine Pfeife im Gesicht. Raucher. Und das wird Kindern gezeigt. Wer behandelt deren Schäden? Und wieso gibt es nicht ein Jahr einen Böögg, das nächste Jahr eine Bööggin? Oder überhaupt mal 100 Jahre nur Böögginnen, um all das Unrecht wiedergutzumachen?
Dann kommt aber ein Hypersensibler und sagt: ich fühle mich sehr unwohl. Die Bööggin erinnere ihn unselig an die Hexenverbrennungen des Mittelalters.
Und dann? Nun, lieber Zünfter, liebe Freunde des Sechseläutens: dann ist fertig mit diesem diskriminierenden, rassistischen, ungesunden Brauch. Das wäre wenigstens mal eine konsequente Forderung. Aber eben, auch beim Tagi arbeiten zu viele Weicheier.