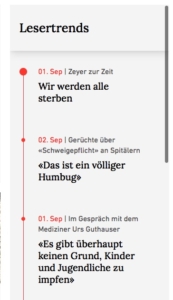Auch so ein hasserfüllter Kämpfer für das Menschenfreundliche, Gute, Richtige und Unbezweifelbare.
Sie gleichen sich verblüffend. Es ist ein weit verbreiteter Typus im modernen Elendsjournalismus. Der mehrfach diplomierte Schreiber, der das Kunststück schafft, gleichzeitig mit dem Zeigefinger zu fuchteln, während er die Tasten betätigt.
Peter Surber verkörpert diese balzacsche Elendsgestalt exemplarisch. Sein erstes Diplom: Er ist ein Schnorrer. Denn fast immer können die Organe, für die Surbers schreiben, nicht aus eigenen Kräften überleben. Eigene Kräfte würde bedeuten: sie stellen etwas her, was genügend Interesse beim Publikum findet, damit auch genügend Geld reinkommt.
Die andere Möglichkeit wäre, seiner Überzeugung, seiner Mission auch aus eben diesen Perspektiven nachzuleben. Und sich die Kohle anders zu verdienen. So wir das bei ZACKBUM auch tun.
Aber niemals, Surber hat nur eine Gesinnung, wenn er dafür bezahlt wird, sie auszudrücken.
Dem stehen aber verschiedene Vorwände entgegen, wieso das nicht möglich sei. Surber arbeitet als Redaktor für das St. Galler «Kulturmagazin Saiten». Das Blatt hat eine Auflage von 5600 Exemplaren. Damit werden 2’200 «Vereinsmitglieder» beliefert und der grosse Rest liegt «in über 250 Kulturinstitutionen und in ausgewählten Restaurants und Geschäften auf». Der neuste Quatschtitel über die Nadel allerdings eher weniger.
Also Geschäftsmodell «TagesWoche», nur lud die den Grossteil ihrer Auflage in Flughäfen ab. Der Unterschied: die «TagesWoche» ist verröchelt, «Saiten» gibt es noch. Die Gemeinsamkeit: Beide Organe wurden oder werden von der «Stiftung Medienvielfalt» ausgehalten. Die übrigens auch dem Quatschblatt «watson» unter die Arme greift.
Geld vom Daig? Wo hört Kultur auf?
Die Stiftung wiederum verbrät damit das Geld einer reichen Pharma-Erbin. Pharma! Basel! Daig! Jeden aufrechten Kämpfer für das Gute und Bessere stellt es die Nackenhaare auf, wenn das Wort Big Pharma fällt. Ausser, man kann gut davon leben.
Zweites Diplom: Was Kultur ist, bestimmen wir. Ein «Kulturmagazin» hat’s natürlich viel leichter, milde Gaben zu erbetteln oder harmlose Leser um «Unterstützung» zu bitten – als ein ganz normales, linkes Wäffelblatt. Erklärung? Einfach. Die Ostschweizer Medienlandschaft «gleiche zunehmend einer Monokultur». Wie wahr, also was tun? «Der gesellschaftliche Diskurs zu sozialen und kulturellen Themen findet kaum noch Platz in den Medien.» Wäre mir neu, aber ich bin ja kein Ostschweizer.
«Durch diese Veränderungen fällt dem Ostschweizer Kulturmagazin Saiten eine neue Rolle zu: Wir sind dadurch vermehrt gesellschaftliche Impulsgeber, Kommentatoren, Seismografen.» Wunderbar, und wie durchbricht «Saiten» diese Monokultur? Nun, einige angepriesenen Themen des Februarhefts: «50 Jahre Frauenstimmrecht», «Reisen 1980 im Sudan», «indonesische Ultras». Unglaublich, wie global doch die Ostschweiz geworden ist.
Dem Seismographen helfen auch gerne fremde Federn
Gerne übernimmt man auch Rechercheergebnisse befreundeter Organe; so beispielsweise einen launigen WoZ-Bericht über «Hummlers Hofstaat», als gerade dessen Bank Wegelin von den USA geschlachtet wurde. Der Ex-Banquier regte sich fürchterlich darüber auf. Als er sich wieder abgeregt hatte, bemängelte er immerhin zu Recht, dass wie es sich für solche Demagogenartikel gehört, er keine Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen hatte.
Diplom drei: Man verwendet gerne zugespielte Dokumente und lässt sich dadurch für unbekannte Motive instrumentalisieren. Macht die «Republik» regelmässig (auch am Saugnapf der Stiftung), macht «Saiten» ab und an, so beim Knatsch um die Lokremise.
Letztes Diplom: Man ist keinesfalls käuflich, niemals. Nur: «Dieses Heft ist in Kooperation mit der Gemeinde Lichtensteig entstanden und von dieser mitfinanziert.» Was nun aber so was von null Einfluss auf die unabhängige, kritische Berichterstattung hatte, aber hallo.
Das Heuchlerdiplom gibt’s ausser Konkurrenz
Ausser Konkurrenz läuft diese Auszeichnung: das Heuchlerdiplom am Band mit Brillanten. Da ja inzwischen alles Kultur ist, vorausgesetzt, Peter Surber schreibt darüber, gehört natürlich auch dieses Geschimpfe dazu: «Im Fall der Wutbürger, Rechtsparteien und ihren Medienkanälen heisst die Parole: Mehr Egoismus, weniger Staat. Mehr Respektlosigkeit, weniger Solidarität.»
Das sei ein «Kommentar», meint Surber, darunter versteht er offensichtlich: null Fakten, 100 Prozent Häme, Verleumdung, Blödsinn. Und eine sehr gepflegte Sprache. Zuerst bekommt Markus Somm sein Fett ab, offenbar ein Angstbiss angesichts der bevorstehenden Lancierung des neuen «Nebelspalter». Somm «wetterte scharf und widerspruchs-resistent gegen den Bundesrat und den Lockdown». Aha, verwendete Somm zufällig auch Argumente dabei? Ach, damit hält sich doch kein Kommentator auf dem Kriegszug auf.
Aber das ist nur die Einleitung mit einer «besonnenen Stimme im Lärm der Rechtspublizistik». Was ist das schon wieder? Man vermutet: alles, was nicht identischer Meinung mit Surber ist. Weniger besonnene? Bitte sehr: «In der «Weltwoche» geifert Noch-SVP-Nationalrat Roger Köppel gegen den «vollgedröhnten» und «verseuchten» Bundesrat.»
Bevor sich Surber selbst den Geifer vom Mund wischt, muss er noch einen drauflegen: «Auf der Plattform ostschweiz.ch marschiert eine ganze Truppe von Schreibern gegen die Coronamassnahmen auf. Letzten Freitag war es als Gastautor der selbsternannte Tierschützer Erwin Kessler.»
Meinungsfreiheit? Aber doch nicht bei Surber
Vor lauter Schaum vor dem Mund fällt es dem selbsternannten Scharfrichter Surber gar nicht auf, dass er hier doch eine Alternative zur angeblichen medialen «Monokultur» erwähnt. Aber papperlapapp, was soll denn ein Kommentar mit Logik am Hut haben. Lieber weiter ins Gebüsch fahren: «Das war sogar dem «Ostschweiz»-Kolumnisten Gottlieb F. Höpli zuviel.» Der beendete wegen des Gastkommentars von Kessler seine Mitarbeit und liess das gleichzeitig mit dem Chefredaktor der «Ostschweiz» auch alle weiteren «Monopolmedien» wissen.
Surber geht unbeschwert von Logik, Tatsachen und anderen Nebensächlichkeiten in die Zielgerade: «Solche Hass-Attacken (wie die von Kessler, Red.) mehrten und mehren sich in dem Mass, wie die SVP in den letzten Wochen ihren letzten Anstand und politischen Verstand verloren hat …», «Staats- und Sozialabbau», «rechte Scharfmacher», Blabla und Blüblü. Ein letzter Stossseufzer: «Man kann sie nicht ändern, denn das Virus bringt nur zutage, was als Haltung, als Charakter, als DNA schon da war.»
Surber als Rassentheoretiker?
Rollen wir das kurz von hinten auf. Surber, der Sozialdarwinist, behauptet doch tatsächlich, die politische Einstellung «rechter Scharfmacher» sei genetisch, charakterlich vorbestimmt. Das trauten sich zuletzt verrückte Rassentheoretiker, ob so ein Schwachsinn im Rahmen der Antirassismus-Strafnorm erlaubt ist? Oder könnte Surber zeitweise Unzurechnungsfähigkeit geltend machen?
Die anderen haben letzte Reste von Anstand und Verstand verloren? Im Gegensatz zu Surber, der einen Noch-NR «geifern» lässt, ein etwas erfolgreicherer Publizist als Surber «wettert widerspruchs-resistent», während «Saiten» dafür bekannt ist, die Spalten des Blatts im Rahmen der Meinungsfreiheit diversen Positionen zu öffnen. Solange sie vegan, politisch korrekt, mit den Meinungen und Vorurteilen Surbers übereinstimmen.
Aber das alles sind eigentlich lässliche Sünden und Dummheiten eines erregten, aber nicht sonderlich begabten Schimpfkanoneurs. Der echte Rohrkrepierer, den Surber auch nicht bemerkt, obwohl er mit schwarzem Gesicht und angekokelten Haaren dasteht, so hat’s gekracht, ist aber: Ich als Autor bei «Die Ostschweiz» bin ganz ausgesprochen mit Kesslers Ansichten nicht einverstanden. Ich teilte auch nicht alle Ansichten von Höpli, genauso wenig die von Stefan Millius oder von vielen anderen Mitarbeitern oder Kommentatoren bei der «Ostschweiz».
Rechthaberei als billiges und ängstliches Gehabe
Aber solange die nicht gegen Strafnormen oder sehr weit gefasste Regeln des Anstands verstossen, bin ich jederzeit und bedingungslos dafür, dass sie publiziert werden. Genauso, wie ich in der «Ostschweiz» meine Meinungen und Artikel veröffentlichen kann, mit denen garantiert auch nicht alle Leser oder Mitarbeiter übereinstimmen.
Ich wäre sogar dafür, dass Peter Surber jederzeit das Wort ergreifen könnte. Selbst die offenkundigen Fehlschlüsse, die blut- und inhaltsleere Polemik, der Ersatz von Argumenten durch Gewäffel würde mich nicht davon abhalten. Ich bin für Meinungsfreiheit als die wohl wichtigste Errungenschaft der Aufklärung und der Neuzeit.
Ich bin auch dafür, dass sich jeder Erwachsene in der Öffentlichkeit zum Deppen machen kann.
Ich bin mir allerdings sicher, dass Surber niemals einen Kommentar von mir auf «Saiten» veröffentlichen würde. Er würde widrigenfalls allerdings auch nicht kündigen, so wie Höpli. Denn wo sollte Surber denn hin? Solche Tiefflieger wie ihn braucht doch kein journalistisches Organ, das selber schauen muss, wie es sich finanziert. Was dem Gewäffel Surbers aus seiner geschützten Werkstatt gegen Somm, Köppel oder Millius noch mehr einen schalen Beigeschmack gibt.