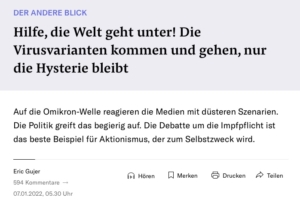Kriegsgeschrei aus der NZZ
Ein weiterer Sandkastengeneral sändelet und zündelt.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Normalerweise beherrscht Eric Gujer den «anderen Blick» der NZZ, mit dem sie sich an ihre reichsdeutschen Leser wendet. Nicht zuletzt damit hat sich das Blatt von der Falkenstrasse in Zürich in Deutschland einen Namen gemacht. Denn Gujers Blick ist meist gnadenlos, er führt eine scharfe Klinge und kann – für einen Schweizer – elegant formulieren.
Aber auch God Almighty muss mal ruhen, dann dürfen andere ran. Da fängt dann der «andere Blick» schwer an zu schielen. Daran schuld ist Marco Seliger. Der deutsche Journalist arbeitet für die deutsche Redaktion der NZZ. Zuvor war er Chefredaktor von «Loyal», der Zeitschrift des deutschen Reservistenverbands, 2020 wurde er Leiter Kommunikation und Pressesprecher der deutschen Waffenschmiede Heckler & Koch. Man kann ihn vielleicht als nicht ganz unbelastet bezeichnen.

In diesem Sinn legt er gleich offensiv los: «Die Ukraine braucht dringend weit reichende Präzisionswaffen», weiss Seliger. Da trifft es sich gut, dass «in der deutschen Armee nicht alles schlecht» sei. Zum Beispiel der «hochmoderne Marschflugkörper Taurus», der gehöre «zu den besten Lenkflugkörpern der Welt». Wunderbar, wenn den Hitlers Armee schon gehabt hätte, wäre die Panzerschlacht bei Kursk vielleicht anders ausgegangen.
Aber es gibt natürlich auch heute Wehrkraftzersetzer und Defätisten, die Seliger scharf zurechtweisen muss: «Mitunter mutet die deutsche Verteidigungspolitik grotesk an.» Kein Wehrwille mehr, keine Angriffslust, nix «Germans to the front», keine Rede von «Marschflugkörper müssen fliegen bis zum Sieg». Stattdessen «gerierten sich ganze Kohorten von Politikern und Wissenschaftlern als Panzerexperten» und diskutierten Für und Wider einer Lieferung von Leopard 2. Kein Wunder: «Russlands Präsident Putin dürfte sich damals schlapp gelacht haben.»
Das mag stimmen, dass Putin darüber lacht, dass in Deutschland doch noch so etwas wie ein Rechtsstaat mit restriktiven Waffenausfuhrgesetzen existiert. Über die sich eine Kriegsgurgel wie der Reserveoffizier Seliger natürlich kaltlächelnd hinwegsetzen würde. Aber während sich Merkel immerhin sichtbar wegguckte, sei Bundeskanzler Scholz «in der Taurus-Frage schlicht nicht präsent». Typisch, haben Sie überhaupt gedient? Antwort: nein, Scholz hat verweigert und Zivildienst geleistet. Aha, Drückeberger.
Es gebe Bedenken, dass die Ukraine solche Distanzwaffen auch auf russischem Gebiet einsetzen könnte? Papperlapapp: «Das Argument, westliche Marschflugkörper würden den Krieg eskalieren, zieht daher nicht. Sie befinden sich bereits im Einsatz.» Aber die sind natürlich nicht so gut wie echte deutsche Wertarbeit: «Der britische Storm Shadow und der französische Scalp sind nur bedingt geeignet, einen Brückenpfeiler zum Einbrechen zu bringen. Taurus aber, so heisst es unter deutschen Militärfachleuten, kann das.» Oder: «wir schaffen das», wie Merkel gesagt hätte.
Also her damit, keine Weichheiten, was muss, das muss: «Eine deutsche Politik, die Sinn für das Wesentliche hat, würde den Taurus deshalb jetzt freigeben.» Aber leider, leider ist es mal wieder so: die deutsche Politik interessiert es einen feuchten Kehricht, was Seliger für den Sinn fürs Wesentliche hält. Glücklicherweise, denn das ist Unsinn. Während es sich beim Taurus offenbar um eine deutsche Präzisionswaffe handelt, ist Seliger ein Unguided Missile.