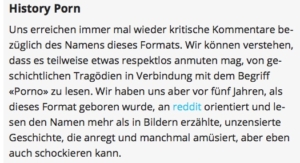Dichtung und Wahrheit, Teil 3
Wie stellt man Gerechtigkeit her, nach so vielen Jahren und so viel Unrecht?
Hier geht’s zu Teil eins und zu Teil zwei.
Wer kann das viele, viele Jahre später noch unterscheiden? «Auch Leben ist eine Kunst», war der Sinnspruch von Max Emden. Das Nachleben der von ihm erworbenen Kunstwerke ist dagegen ein Trauerspiel.
Soll es darum gehen, ein Unrecht wieder gutzumachen? Ist es statthaft, was damals Recht war, heute als Unrecht zu denunzieren? Das trifft sicherlich auf die Raubzüge der Nazis gegen jüdische Besitztümer in ihrem Einflussbereich zu. Trifft das auch auf die Schweiz zu?
Spielt es in diesem Fall eine Rolle, welche Politik die Schweiz gegenüber Juden im Allgemeinen verfolgte? Spielt es eine Rolle, wie der Käufer zu seinem Vermögen kam?
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Gerechtigkeit, wenn es so etwas überhaupt gibt, wird nicht durch Rechthaberei hergestellt. Einem Dialog ist es sicher nicht zuträglich, wenn der älteste Sohn des Verkäufers öffentlich behauptet, man habe ihm damals von Seiten der Stiftung «ins Gesicht gelacht». Einem Dialog ist es auch nicht zuträglich, wenn der Präsident der Stiftung formaljuristisch wird und festhält, dass alle Ansprüche sowieso längst verjährt seien.
Handelt es sich hier um einen Streit, bei dem damaliges Unrecht ziemlich genau 80 Jahre später geheilt werden soll? Schaffen da Kampfbegriffe wie «unter Ausnützung einer Notlage von Juden abgepresste Kunstwerke, bezahlt durch Einkünfte aus Waffenlieferungen an die Nazis», Gerechtigkeit?
Wieso bricht dieser Konflikt erst jetzt wieder aus? Die Herkunft der Werke in der Bührle-Sammlung war schon längst vor der Eröffnung der Ausstellung im Kunsthaus Zürich bekannt. Untersucht, umstritten, wieder untersucht, immer noch umstritten. Wobei die Stiftung bestreitet, dass etwas umstritten sei. Seit 2010 ist öffentlich auf der Webseite der Stiftung ein Bericht über die Lebensumstände von Juan Enrique oder Hans Erich Emden sowie über den Bildverkauf einsehbar – und niemals bestritten.
Muss nun 20 Jahre nach seinem Tod, 80 Jahre nach dem Tod von Max Emden, Unrecht geheilt werden? Verblasst der Streit um diesen Monet vor dem Riesenunrecht, das Emdens in Deutschland angetan wurde, ohne nennenswerte Sühne bis heute?
Kann die Stiftung als Wahrheit verkünden, dass es keinen einzigen Fall von problematischer Provenienz eines Kunstwerks in ihrem Besitz gebe? Dass alle allfälligen Restitutionsforderungen zu Recht zurückgewiesen worden seien – oder in Form von Vergleichen erledigt wurden?
Will hier ein Erbe am gewaltigen Wertzuwachs eines Gemäldes profitieren, dessen heutiger Schätzpreis von über 25 Millionen Franken überhaupt nichts mit den damaligen Preisen zu tun hat?
Wie unterscheidet man zwischen Dichtung und Wahrheit?
Ist es Dichtung oder Wahrheit, dass diese Wertsteigerung nicht zuletzt durch öffentliches Ausstellen entstand? Weiss man, was mit dem Gemälde geschehen würde, sollte es tatsächlich in den Besitz der Erben übergehen?
Dichtung oder Wahrheit, einem solchen Gespinst, solchen Verwicklungen, die tief in dunkle Kapitel der europäischen Geschichte zurückreichen, denen kann man nur – wenn man an Wahrheit interessiert ist – mit feinem Besteck beikommen, mit dem archäologischen Pinsel viel eher als mit dem Zweihänder oder dem Vorschlaghammer.

Das perfekte Feindbild.
Wie absurd die Debatte geworden ist, beweist eine kleine Auslegeordnung. Status quo ist, dass diese Werke als Leihgabe im Kunsthaus Zürich hängen. Ihre Herkunft und die Biographie des Sammlers ist in einem eigenen Raum dokumentiert. Was für Alternativen dazu gibt es?
- Der Leihgeber zieht die Sammlung wieder zurück.
- Einzelne Werke werden der Öffentlichkeit entzogen, bis ihre Provenienz nochmals abgeklärt wurde.
- Die Sammlung wird verstaatlicht.
- Einzelne Werke werden an die Erben der Verkäufer zurückgegeben
- nur an die, die das fordern
- aus Gleichbehandlungsgründen an alle
- Es wird auch für diese Sammlung der Begriff «NS-bedingter Kulturverlust» angewendet oder das Prinzip der «freiwilligen» Rückgabe, das vom Kunstmuseum Bern in Bezug auf die Gurlitt-Sammlung angewendet wird.
- Es werden weitere Kommissionen einberufen, die mit Steuergeldern finanziert nochmals versuchen, die Provenienz aller Kunstwerke zu überprüfen.
Es gäbe noch weitere Spielarten, aber allen ist gemeinsam: die gesamte Sammlung, oder zumindest Teile davon, würden der Öffentlichkeit entzogen werden.
Alle verlieren, auch die Wahrheit
So kann es nur Verlierer geben. Die Wahrheit gehört dazu. Einzig profitieren tun alle, die sich hier ihr eigenes Süppchen kochen wollen, ihre politischen Urteile und Vorurteile ausleben, mit billigen Propagandabegriffen die Lufthoheit über dem Stammtisch der öffentlichen Meinung erobern wollen.
Also letztlich nicht nach Wahrheit oder gar Gerechtigkeit suchen, sondern nur nach öffentlicher Aufmerksamkeit. Durch einseitige Skandalisierung oder gar durch absurde Forderungen nach Rückkauf eigener Werke, weil die nicht in der Nähe dieser Sammlung hängen dürften.
In der Woke-Gesellschaft das übliche Vorgehen. Mangels eigenem Leiden vergreift man sich an fremdem, längst vergangenem. Um dann bühnenreif und mit geradezu schillerschem Überschwang («nimm das, Schurke») eine jämmerliche Performance abzuliefern.
Das gilt bedauerlicherweise für eigentlich alle Beteiligten an diesem künstlichen Trauerspiel. Die Stiftung als Rechtsnachfolgerin des Käufers hätte genügend Zeit gehabt, sich auf die absehbare Welle an Kritik vorzubereiten. Das hat sie unterlassen, blieb zunächst sprachlos, um dann mit einer dilettantischen Pressekonferenz mehr Öl ins Feuer zu giessen.
Das Kunsthaus als Gastgeber für die Ausstellung verwickelte sich ebenfalls unnötigerweise in Widersprüche und Fragwürdigkeiten, liess es an aller Sensibilität gegenüber einem solch aufgeladenen Thema missen.
Die Zürcher Regierung bedient jedes Vorurteil, dass man gegenüber opportunistischen Politikern nur haben kann. Die Stadtpräsidentin jubelte noch bei der Eröffnung des extra für diese Sammlung errichteten Erweiterungsbaus und badete in der hellen Sonne dieses neuen kulturellen Highlights, das Zürich als Museumsplatz in die Oberliga weltweit befördert.
Als erste Kritiken laut wurden, reagierte sie abwiegelnd, dann mit dem üblichen Rückzug, dass hier nochmals untersucht und abgeklärt werden müsse. Inzwischen, nachdem der Wind etwas stärker bläst, sieht sie auch plötzlich Probleme und Schwierigkeiten bezüglich einer weiteren Ausstellung der Werke.
Nach der missglückten Pressekonferenz sägt sie nun kräftig am Stuhl des eigentlich erst per Ende 2022 abtretenden Kunsthaus-Direktors und würde es begrüssen, wenn dieses «Dossier» so schnell wie möglich an seine Nachfolgerin übergehen würde.
Wieso nicht gleich wieder rauben?
Die Süppchenkocher auf längst Vergangenem, aber noch nicht Erledigtem, fordern mehr oder minder unverblümt Einblick in vertrauliche Vertragswerke und entweder die Rückgabe diverser Gemälde oder gleich die Verstaatlichung, getarnt als «Schenkung» an das Kunsthaus. Nachdem diese Verträge veröffentlicht wurden, brach grosse Enttäuschung aus: es gab nichts zu skandalisieren.
Eine Schenkung einfordern, das ist nassforsch. Würden sich solche Vergleiche nicht verbieten, kämen Analogien zum Vorgehen in dunklen Zeiten des letzten Jahrhunderts in den Sinn.
Sozusagen als materiell gewordener Ausdruck einer zunehmenden Hysterie fordert ein nicht mehr kandidierender Stadtrat sogar, dass man Kunsthaus eine Bührle-Kanone auf den Marmorboden mitten in Ausstellung stellen solle. Damit würde «die Finanzierung der Sammlung aus Kriegsgewinnen» gleich sichtbar.
Wie wäre es mit Brunnen mit rotgefärbtem Wasser in den Empfangshallen der Schweizer Banken, als Erinnerung an die Blutgelder, die hier aufbewahrt wurden oder werden? Fotos von Tieren in Schlachthöfen in Metzgereien. Darstellungen von Sweatshops der Dritten Welt in Kleiderläden. Nachbauten von engen Tunneln, in denen kleine Kinder nach seltenen Erden graben, in Handyläden.
Der schärfste Kritiker der Ausstellung der Sammlung, der in der «Republik» eine ganze Artikelserie darauf verbriet und dem Enkel des Kaufhauskönigs eine Plattform gab, seine Vorwürfe zu wiederholen, sprach sich zehn Jahre zuvor noch lebhaft für den Neubau und die grossartige Ausstellung aus. Daniel Binswanger ist ein Opportunist, Wendehals und Schwulstschwätzer erster Güte.
Soll die Sammlung der Öffentlichkeit entzogen werden?
Allen Beteiligten ist nicht klar, dass sie daran arbeiten, dass eine der bedeutendsten Sammlungen impressionistischer Kunst der Öffentlichkeit entzogen werden könnte. Allen Beteiligten ist nicht klar, dass sich – je nach weiterer Entwicklung – andere Privatsammler dreimal überlegen, ob sie ihre Kollektionen als Leihgaben an öffentliche Museen weiterreichen.
Ist es so, dass man sich beim Betrachten des blutroten Mohnfeldes von Monet an blutgebadete Schlachtfelder erinnern muss? Ist es so, dass man sich beim Betrachten des mit Wolken hingetupften Himmels an Kamine eines KZs erinnern muss? Haben die drei Frauen im Mohnfeld beim Blumenpflücken ihre Unschuld verloren, weil sie in den Besitz eines Waffenfabrikanten gerieten?
Muss man bei ihrem Anblick an das Lied «Sag mir, wo die Blumen sind?» denken? Muss man sich fragen, wie es sein kann, dass ein solches Gemälde einen Schätzwert von über 25 Millionen Franken hat?
Oder kann man das Gemälde so betrachten, wie es vom Maler wohl beabsichtigt wurde: als erhebender und erbaulicher Anblick einer künstlerisch hochstehenden Verarbeitung der Realität? Als Bereicherung, nicht für den Besitzer, sondern für den Betrachter.
Wäre das naiv, unstatthaft? Oder wäre das die Rückführung eines Kunstwerks auf seinen eigentlichen Sinn und Zweck? Erbauung, Erhöhung, Erweiterung, Einblick, Bewunderung der Kunstfertigkeit eines Malers?
Sollte der Betrachter Scham und Schuld empfinden müssen? Gar die Augen schliessen, den Anblick boykottieren? Oder sollten sich all die öffentlichen Kritiker schämen, die sich in Unkenntnis der Vergangenheit mit geraubtem Leiden schmücken, sich ohne jede Legitimation zu moralischen Scharfrichtern aufspielen?
Wer weiss die Antwort? Wer wohlfeile Antworten hat, sollte besser schweigen. Damit wäre allen und der Kunst gedient.