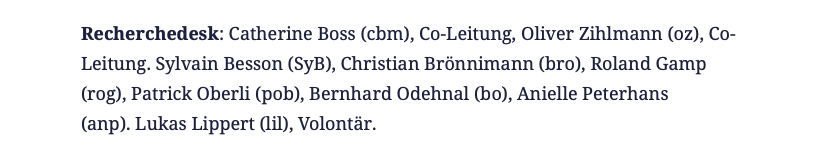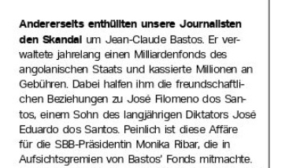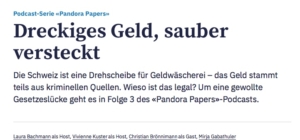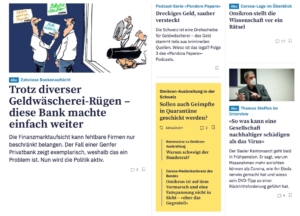So macht man das
Da sieht das «Recherchdesk» von Tamedia alt aus.
8 Nasen plus ein Volontär. Natürlich Co-Leitung Weiblein, Männlein, anders geht das heutzutage nicht mehr. Kostet Tamedia im Monat locker 100’000 Eier. Und was kommt raus? Monatelanges Rumrühren in gestohlenen Dokumenten, dann wird die Hehlerware mit grossem Trara als «Papers», «Leaks» oder «Secrets» verkauft, Trommelwirbel und grossspurige Ankündigungen, was für Schlaglichter hier ins internationale Gangstertum geworfen werden. Kriminelle Gelder, Korruption, Putin-Connection, Mafia, Wahnsinn.
Anschliessend schnurrt der Riesenskandal zum Mäuseskandälchen zusammen, wenn es überhaupt gelingt, ihn zu einem Ereignis aufzupumpen. Meistens werden Tote, Unschuldige und Menschen im gegendarstellungsfreien Ausland ans mediale Kreuz genagelt, die völlig legal Finanzkonstrukte verwenden, die mangels anderen Beschimpfungsmöglichkeiten als «illegitim» denunziert werden. Ein Synonym für: ist legal, aber passt uns nicht. Ein Synonym für: reicher Sack, Trust auf einer kleinen Insel, ist sicher was faul dran. Irgendwas.
Neben diesem Wühlen in Gigabyte bleibt keine Zeit für wirkliche Recherche im näheren Umfeld. Wie man das macht, haben gerade die Jungjournalisten von Izzy Projects vorgeführt.

Die haben rund ein Jahr damit verbracht, sich um ein Thema zu kümmern, das viel wichtiger ist als die angebliche Entlarvung irgendwelcher Figuren, die mit der Schweiz nicht das geringste zu tun haben. Denn das Phänomen der Enkeltrick-Betrüger grassiert tatsächlich hierzulande, die Deliktsumme ist vielleicht nicht so spektakulär wie die Millionen, mit denen die Leaks-Melker hantieren, aber es kann jeden treffen.
Also haben die Mannen um Cedric Schild einigen Aufwand betrieben, um ein paar solcher Betrüger vor laufender Kamera blosszustellen. Telefonnummern en gros angemietet, sie mit altertümlichen Namen registriert und dann gewartet, bis der erste dieser Gangster mal anruft. Alles dokumentiert vom Erstkontakt bis zur Geldübergabe und dem Einsatz der Polizei.
Schliesslich ist daraus ein hübscher Dokustreifen entstanden, und ein paar Betrüger wurden auch aus dem Verkehr gezogen. Das ist nun eine erweiterte Undercover-Recherche im besten Sinn von Günter Wallraff (Tamedia-Redakteure: kann man googeln).
Alleine die Kantonspolizei Zürich vermeldete im Jahr 2023 über 190 vollendete Betrügereien, wobei die Dunkelziffer, die nicht zur Anzeige gebracht wurde, deutlich höher liegen dürfte.
Die NZZ berichtet bewundernd: «Die Recherche verlangte vom Team auch Mut. Die Teammitglieder kamen nah an die Geldabholer heran, hinderten sie im Treppenhaus daran, abzuhauen, oder rannten ihnen im Zürcher Kreis 4 fast bis zum Hauptbahnhof nach,mit Mikrofon und Kamera. Später erhalten sie denn auch Drohungen übers Telefon.»
Am Schluss wurde eine Doku draus, die vermenge «Comedy, Berichterstattung und Verbrecherjagd» (NZZ). Selbst der verschnarchte Presserat findet an dem Vorgehen nicht wirklich was auszusetzen. Reale Kriminelle jagen, darüber berichten und das Ganze noch unterhaltsam aufbereiten, das ist mal ein kleines Wunderwerk aus dem Hause Ringier.
Sollte sich die Chefetage bei Tx, hallo, Herr Supino, die Doku reinziehen, dürfte sie sich fragen, wofür eigentlich das Medienhaus dermassen viel Geld für ein Recherchedesk aufwirft, das zwar vor Bedeutung und Wichtigkeit kaum geradeaus laufen kann, aber eigentlich im Wesentlichen am Schreibtisch sitzt und einen Bürojob absolviert. Mitglied Christian Brönnimann fällt wenn überhaupt mit rechthaberischen Kommentaren auf: «Die Schweiz profitiert einmal mehr von grossem Unrecht». So ist die Schweiz halt, wir alle sind Profiteure davon, dass es auf der Welt ungerecht zu und her geht.
Wie das? Die Schweiz konfisziert Gelder kriminellen Ursprungs, wenn sie seiner habhaft wird. Dann stellt sich das Problem, ob und an wen es zurückgegeben werden sollte. Selbst Brönnimann räumt ein: «Es leuchtet ein, dass die Schweiz konfiszierte Gelder nicht einfach blindlings in einen Unrechtsstaat zurücküberweisen kann. Zu gross wäre das Risiko, dass es dort gleich wieder in korrupte Kanäle verschwindet.»
Dann hat er aber eine geniale Idee: «Die Schweiz könnte beispielsweise einen Fonds schaffen für zusätzliche Entwicklungsprojekte in jenen Ländern oder Regionen, aus denen das Geld ursprünglich geraubt wurde.»
Als ob sogenannte Entwicklungshilfe, siehe Swissaid und andere Veranstaltungen, nicht auch massenhaft «in korrupte Kanäle» verschwinden würde, ganz abgesehen davon, dass sie bekanntlich keinen nennenswerten Effekt hat. Obwohl seit der Unabhängigkeit Multimilliarden verlocht wurden, geht es den meisten schwarzafrikanischen Staaten heute schlechter als vor 50 Jahren.
Aber mit solchem Unfug und Rechthabereien und unsinnigen Vorschlägen vertreibt sich das Recherchedesk von Tamedia die Zeit. Deren Gehälter haben eine fatale Ähnlichkeit mit dem Geld, das in Entwicklungshilfe versickert.