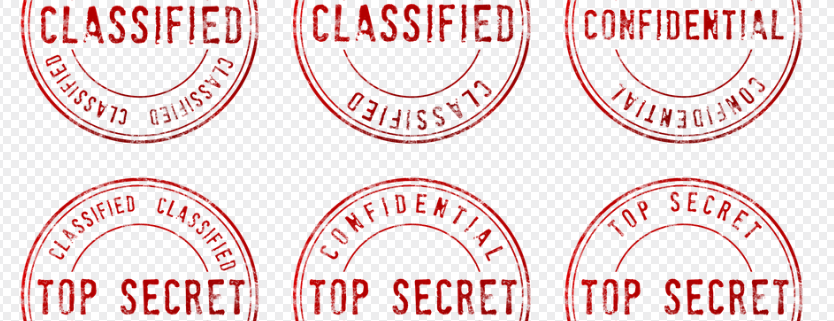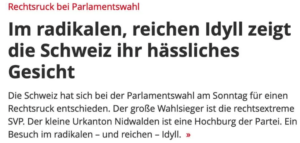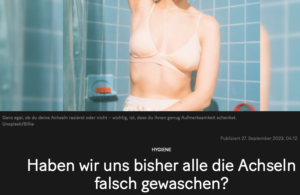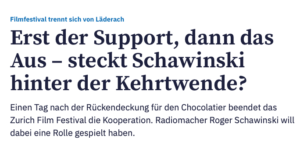Neues Jahr in alten Schläuchen
ZACKBUM schaut in die Glaskugel.
Es kann natürlich Unvorhersehbares geschehen. Diese Packungsbeilage bei Prognosen muss vorangestellt werden. Dafür verzichtet ZACKBUM auf alle Schwurbeleien wie «wenn nicht, falls, unter Voraussetzung, dass».
In der überschaubaren Medienlandschaft der Schweiz gibt es vier grosse Player. In einer Liga für sich spielt die SRG, da zwangsgebührenfinanziert. Ringier, Tamedia und CH Media müssen sich am Markt behaupten – und versagen vor den Herausforderungen des Internets.
Dann haben wir noch kleine und kleinste Player wie die NZZ, die «Weltwoche», Das Lebrument-Imperium, Randgruppenorgane wie die WoZ, die «Republik» und mehr oder minder erfolglose lokale Internet-Plattformen. Und wir haben den in seiner Bedeutung noch viel zu wenig erforschten Bereich der Community-Plattformen, über die immer grössere Teile der Gesellschaft, vor allem Jugendliche, ihr Informationsbedürfnis abdecken.
Das ist die Landschaft im Jahr 2024, was erscheint nun im wolkigen Inhalt der Glaskugel? Das:
- Die drei privatwirtschaftlichen grossen Player werden weiterhin sparen. Also teure Mitarbeiter abbauen und sie zunehmend durch KI ersetzen.
- Durch ihre Kamikazepolitik, für weniger Leistung mehr Geld zu fordern, werden sie weiter deutlich an Lesern und Einnahmen verlieren, der Teufelskreis dreht sich schneller.
- Die tägliche Printausgabe wird zum Auslaufmodell. Bereits ist aus dem «Sonntag» die «Schweiz am Wochenende» geworden. Die ehemals unabhängigen Redaktionen der Sonntagszeitungen werden vollständig in die höllischen Newsrooms integriert, die Sonntagsausgaben werden im Print verschwinden.
- Der Anteil der Lokalberichterstattung in den zahlreichen Kopfblättern wird weiter reduziert. Statt in Content zu investieren, wird in die Quadratur des Kreises Geld verpulvert, die zentral gekochte Einheitssauce ein Dutzend mal anders einzufärben, damit sie in Basel, Bern, St. Gallen, Luzern oder Aarau verschieden daherkommt.
- Es wird allgemein mehr administriert, weniger produziert. Die kabarettreife Anzahl von Heads und Chiefs bei Ringiers «Blick»-Familie gibt den Kurs vor.
- Nachdem Ringier die Organe von Axel Springer Schweiz geschluckt hat und verdauen muss, wird Tamedia versuchen, den angeschlagenen Wannerkonzern zu schlucken.
- In der Medienwelt hat 2024 das kapitalistische Prinzip – die Ausgaben werden durch die Einnahmen gedeckt – abgedankt. SRG ist zwangsfinanziert, die drei grossen Konzerne werden einen neuen Anlauf nehmen, die Steuersubventionen heraufzuschrauben. Nischenorgane wie die «Republik» werden weiterhin nur dank grosszügiger Mäzene und Spender existieren. Beim Markttest, gibt es genügend zahlungsbereite Nachfrage für das Angebot, sind sie gescheitert.
- Durch diese Konzentration bekommen ganz wenige Personen eine ungeheuerliche Machtfülle in den Medien. Das wäre Gilles Marchand als Generaldirektor der SRG, Pietro Supino als Boss von Tamedia und Vertreter des Coninxclans, CH-Media-CEO Michael Wanner als Vertreter des Wannerclans, Michael Ringier, Marc Walder und Ladina Heimgartner bei Ringier. Auch nicht unbedeutend ist Eric Gujer als Geschäftsführer und Oberchefredaktor der NZZ. Von denen (ihren Fähigkeiten und Interessen) hängt es ab, wie schnell die Talfahrt der Deutschschweizer Medien weitergeht. Was sie bisher geboten haben, stimmt nicht optimistisch.
- 2024 wird der Anspruch der Massenmedien, die öffentliche Meinung zu repräsentieren und zu manipulieren, immer weiter abbröckeln. Der «Blick» als entkerntes ehemaliges Boulevardblatt hat sich bereits davon verabschiedet, CH Media will gar nicht diesen Anspruch erheben, Tamedia wird auch 2024 nicht bemerken, dass seine Einschätzungen, Kommentare und Meinungen nicht mehr interessieren. Auch die NZZ überschätzt sich hierbei gewaltig.
- Die unglaublich schrumpfende Bedeutung der Massenmedien macht die Beantwortung der Frage dringlich, ob es ein Kontrollorgan wie ZACKBUM Ende 2024 überhaupt noch braucht.