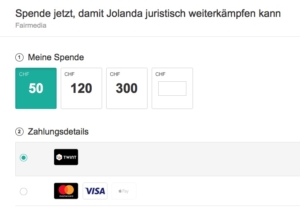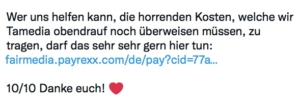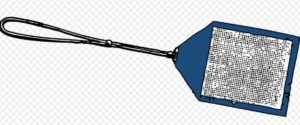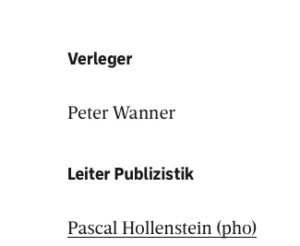Schwarzer Tag für Schwarzenbach
Justizverbrechen von Fall zu Fall.
Am Beispiel des Geldverwalters und Kunsthändlers und Besitzers des Hotels Dolder Grand lässt sich sehr schön das Funktionieren eines Rechtsstaats aufzeigen.
Urs Schwarzenbach bewegte grössere Geldsummen. Ob das eigenes Geld ist oder er, wie viele vermuten, einfach der Strohmann für den Scheich von Brunei ist, was soll’s. Die flüssigste Methode, heutzutage grössere Beträge herumzuschieben, ist der Kunsthandel. Dort werden seit Jahren Mondpreise für Kunstwerke bezahlt.
Die sind gleichzeitig leicht transportierbar, ein Gemälde kann man rollen und in eine Pappröhre stecken. Und in seinem Privatjet mitführen. Genau das tat Schwarzenbach regelmässig, und dafür wollte die Zolldirektion 11 Millionen für Kunstwerke, die Schwarzenbach am Zoll vorbeigeschmuggelt hatte.
Das zahlte er nicht, erhob auch Beschwerde gegen Zahlungsbefehle. Das führte dann zur spektakulären Aktion, dass im Dolder Grand vor staunenden Gästen diverse Kunstwerke abgehängt und beschlagnahmt wurden. Zum Schluss unterlag Schwarzenbach vor dem Bundesgericht.

Das ist ihm nun auch in zwei Verfahren gegen die Kantonalzürcher Steuerverwaltung passiert. Schon zuvor wurde er zur Nachzahlung von 40 Millionen Franken verurteilt. Darauf kommen nun noch weitere 120 Millionen. Plus Zinsen. Plus die Verfahrenskosten von insgesamt 290’000 Franken. Plus Anwaltskosten.
Ein kleines Sparpotenzial gäbe es höchstens bei seinem Sprecher. Es braucht eigentlich keinen Katastrophen-Sacha Wigdorovits, um auf Anfrage zu knirschen: «Herr Schwarzenbach bedauert, dass das Bundesgericht seinen Argumenten nicht gefolgt ist, und ist mit diesem Urteil nicht einverstanden.»
Das ist sein gutes Recht, so wie es sein Recht war, seine Ansicht durch alle Gerichtsinstanzen zu verteidigen. Was dazu führte, dass erst jetzt ein Steuerfall abgeschlossen ist, der die Zeit von 2005 bis 2013 betrifft. Langsam mahlende Mühlen.
Zweierlei Recht?
Ganz anders sieht es allerdings aus, wenn man über zwei Eigenschaften in der Schweiz verfügt. Einen russischen Nachnamen und bedeutende Vermögenswerte. Dann funktioniert der Rechtsstaat so: mit seinem russischen Nachnamen kommt der Besitzer in irgendwelchen Reichen-Listen vor. Gerne genommen werden die Aufstellungen der Zeitschrift «Forbes». Ist das so, genügt das, allenfalls noch ergänzt durch einen fotografischen Beweis, dass der Russe irgendwann einmal im gleichen Raum wie Wladimir Putin war, damit er auf eine Sanktionsliste der USA kommt.
Ist das der Fall, müssen alle Finanzhäuser, Firmen und Geschäftspartner blitzartig auf Distanz zu diesem Russen gehen. Gleichzeitig wird diese Sanktion von der EU übernommen, was bedeutet, dass sie automatisch auch von der Schweiz übernommen wird. Ein schönes Beispiel nebenbei, dass die automatische Übernahme ausländischer Rechtsentwicklungen mehr als problematisch ist. Denn die Schweiz hat keinerlei Möglichkeit, sich eine eigene Meinung über die Rechtmässigkeit dieser Sanktion zu bilden.
Ist der Russe so sanktioniert, dann beginnt die Beschlagnahme aller seiner Vermögenswerte, die mit ihm in Verbindung gebracht werden können. Dafür muss er als sogenannter beneficial owner identifiziert werden, also als eigentlich Nutzniesser. Auch das ist nicht immer so einfach, denn reiche Personen neigen ganz allgemein dazu, ihre Vermögen in eher komplizierten Holding- und Truststrukturen aufbewahren zu lassen.
Was übrigens fast immer völlig legal ist. Obwohl die ewigen Schreihälse beim Ausschlachten gestohlener Geschäftsunterlagen, auch als «Leaks» oder «Papers» bekannt, immer insinuieren, dass alleine die Tatsache, im Besitz einer solchen Konstruktion zu sein, automatisch das Verdikt «illegitim» verdiente, das Ersatzwort für illegal, das Einstiegswort zu Schwarzgeld, Steuerhinterziehung, krumme Geschäfte, asozial, verantwortungslos, egoistisch.
Die Beweisumkehr
Nun ist die Sicherheit solcher Konstrukte auch nicht mehr das, was sie einmal war. Also wird die Jacht, die Villa, die Kunstsammlung, der Safe mal beschlagnahmt. Sollte der reiche Russe nicht nur Besitzer davon sein, sondern die Wertgegenstände wider Erwarten auch legal erworben haben, soll er das doch erst mal beweisen.
Es gibt allerdings eine kleine Ausnahme von dieser Regel. Ist der Oligarch nicht nur reich und Putin nahe, sondern spielt er eine wichtige Rolle in der Versorgung Europas mit Rohstoffen, dann hat er (vorläufig) Schwein gehabt. In diesem Fall, und nur in diesem, kommt er auf keine Sanktionsliste.
Man sieht den Unterschied und ist verstimmt. Im Fall Schwarzenbach musste nachgewiesen werden, dass er zu Recht zur Zahlung dieser Summen aufgefordert wurde. Er musste nicht beweisen, dass er in Wirklichkeit unschuldig und nicht zahlungspflichtig sei. Das ganze Prozedere dauerte fast 20 Jahre; erst jetzt sind diverse Summen zur Zahlung fällig.
Im Fall eines russischen Reichen gilt Rechtsstaat pervers. Bei ihm braucht es keinen rechtsgültigen Zahlungsbefehl, es braucht auch keine langwierigen Gerichtsverfahren. Sein Eigentum wird schlank und ratzfatz enteignet. Eigentumsgarantie, Unschuldsvermutung, Recht auf ein ordentliches Verfahren? Ach was, besondere Umstände erfordern besondere Massnahmen. Es gilt die Schuldvermutung; der Beschuldigte soll halt seine Unschuld beweisen, dafür steht ihm der Rechtsweg offen.
Ganz wilde Abenteurer im Rechtsstaat fordern inzwischen sogar, dass diese eingezogenen Vermögen verwertet und der Ukraine ausgehändigt werden sollen. Feuchte Träume kommunistischer Revolutionäre könnten wieder einmal wahr werden. Diesmal nur im Kapitalismus.