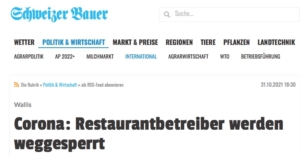Courage
Der Name ist Courage. Zivilcourage. Schon mal davon gehört?
Liebe Gemeinde, heute wollen wir den besinnlichen Sonntagstext dem Begriff Zivilcourage widmen. Damit wird dieser Bürgermut vom Mut auf dem Schlachtfeld abgegrenzt. Angeblich soll ihn der deutsche Kanzler Otto von Bismarck als einer der Ersten verwendet haben:
«Mut auf dem Schlachtfelde ist bei uns Gemeingut, aber Sie werden nicht selten finden, dass es ganz achtbaren Leuten an Zivilcourage fehlt.»
Woran fehlt es denn auch in der Schweiz ganz achtbaren und auch weniger achtbaren Leuten? Einfach das, was der «Beobachter» schon lange mit seinem «Prix Courage» auszeichnet? Also ganz allgemein Menschen, die bereits sind, ihre Komfortzone zu verlassen, umd sich für eine von ihnen so empfundene gerechte Sache einzusetzen.

Der Handelnde ist bereit, dafür Nachteile in Kauf zu nehmen, die Macht zu Reaktionen zu provozieren, setzt sich für andere ein, kämpft gegen Ungerechtigkeit, für allgemeine Werte, die er in Gefahr sieht.
Von Mut zu Zivilcourage
Der Applaus ist hier nicht so sicher wie bei einem mutigen Passanten, der unter Einsatz des eigenen Lebens ein Kind vor einem herbeibrausenden Lastwagen rettet. Denn wenn der mit Zivilcourage ausgestattete Mitmensch sich für «falsche» Ziele einsetzt, bekommt er kaum Lob, nur Nachteile und meistens auch eine gesunde Portion Häme ab.
Interessant ist zunächst auch, dass in Frankreich – man merkt halt den Unterschied zwischen einer Geschichte mit gelungener Revolution oder ohne – die Bürgertugend entweder als «courage civil» daherkommt, womit der «Mut zum eigenen Urteil» gemeint ist, oder als «courage civique», ganz allgemein staatsbürgerlicher Mut.
Aber schon die Verwendung des Begriffs Tugend zeigt, dass das alles etwas aus der modernen Zeit gefallen ist. Auch hier findet eine Entwertung von Begrifflichkeiten statt. Ein Daumen hoch unter einem beliebigen Aufruf auf Facebook wird schon von vielen als Ausdruck besonderer Zivilcourage empfunden.

Auch Schule schwänzen und sich an sogenannten «Fridays for Future» zu versammeln, weil «Sundays for Survival» nicht so knackig daherkommt und Sonntag sowieso Freizeit ist, gilt bei vielen als ganz starker Ausdruck von Zivilcourage.
Fast schon im Sinne von Gandhi oder Martin Luther King wird gehandelt, wenn man sich mit gesenktem Haupt niederkniet, und als privilegiertes weisses Kid grölt: «Black Lives matter». Um dabei mit dem neusten iPhone ein Selfie für Tiktok zu schiessen, wobei darauf geachtet werden muss, dass die neusten Markensneakers auch scharf im Bild zu sehen sind. Wozu hat man sonst 350 Franken dafür ausgegeben.

Völlig pervertiert ist der Begriff Zivilcourage dann, wenn aus geliehenem Leiden vermeintlich mutige Forderungen abgeleitet werden. Am besten ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis zur Verwicklung in die Sklaverei. Ein Bekenntnis gegen den Mohrenkopf. Dabei werden auch gerne Begriffe wie «Zeichen setzen» verwendet. Steigerbar zu «deutliches Zeichen», noch besser: «deutliches Zeichen der Solidarität». Kostet nichts, schadet nichts, nützt nichts, aber der Zeichensetzer fühlt sich deutlich gebessert, geläutert, ist erfüllt von edlen Empfindungen.
Zivilcourage ist immer Schwimmen gegen den Mainstream
Zivilcourage im nicht pervertierten Sinn hat immer etwas damit zu tun, dass man sich nicht auf eigenen Vorteil bedacht für etwas einsetzt. Oft auch für etwas, ohne das man selbst bequem und problemlos leben könnte. Mutig wird Zivilcourage dann, wenn man weiss, dass man gegen den Mainstream rudern wird.
Entweder einen Meinungsmainstream, dann setzt es Shitstorms und sonstige Beschimpfungen ab. Oder aber, man fordert die Macht heraus, kämpft also beispielsweise gegen eine grosse Bank, Big Pharma, eine transnationale Bude, die täglich mehr Geld für Heerscharen von Anwälten und PR-Managern ausgibt, als der bürgermutige Mensch im ganzen Jahr verdient.
Auch bei Zivilcourage ist der Schritt vom Erhabenen ins Lächerliche kurz und klein. Ein gutes Kriterium, ob es mutige oder lächerliche Zivilcourage ist, ist die Konkretheit der Forderung oder des Anliegens. Wer die Welt, das Klima retten will, gegen den Krieg ist, auch etwas gegen den Hunger hat, ist meistens lächerlich.
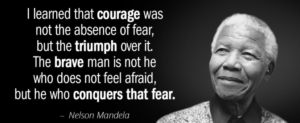
Wer sich für das Allgemeinwohl um sich herum einsetzt, an seinem Arbeitsplatz kämpft, die soziale Ächtung der Nachbarn in Kauf nimmt, genau weiss, dass er mit Schweigen davonkäme, aber trotzdem aufsteht und seine Meinung öffentlich hören lässt: das sind Beispiele von Zivilcourage, die meistens nicht lächerlich ist.
Ach, und bevor Nora Zukker fragt: Bertolt Brecht hatte die Courage, aus Grimmelshausens «Ertzbetrügerin und Landstörtzerin Courasche» sein Theaterstück «Mutter Courage und ihre Kinder» zu machen. Trotz des kommunistischen Autors und der darin enthaltenen Kritik am Kapitalismus als Ursache vieler Kriege hatten viele Theaterregisseure den Mut, es aufzuführen.

Heute ist es eher vergessen, von den Spielplänen verschwunden, viele Nachgeborene fragen: Was ist denn das, und wer ist Brecht, und was ist Courage?
Mehr Zivilcourage, bessere Gesellschaft
Verallgemeinernd kann man sagen, dass das Vorhandensein von Zivilcourage in einem direkten Zusammenhang mit dem Wohlergehen einer Gesellschaft steht. Ist Zivilcourage nur schwach ausgeprägt, ist es für Unterdrückerregimes einfacher, sich an der Macht zu halten. Beherrscht Untertanengeist die Menschen, die fraglose Akzeptanz von Autoritäten, dann ist es leichter, Willkür und Ungerechtigkeit herrschen zu lassen.

Viele, die Zivilcourage zeigen, erleben das Urteil der Geschichte, falls man überhaupt von ihnen Notiz nimmt, nicht mehr. Sie können zum abschreckenden Beispiel eines fehlgeleiteten Aufrührers werden, denn man völlig zu Recht sanktionierte, stigmatisierte, vielleicht sogar liquidierte. Oder aber, es ist ein unerschrockener Kämpfer gegen Unrecht entstanden, ein neuer Gandhi, ein Mandela, einer der wenigen Lichtgestalten in der Geschichte, die sich vor allem durch eines auszeichneten: persönlichen Mut und Unbeugsamkeit.

Oder wie sagte Georges Danton so richtig auf die Frage, was denn einen Revolutionär auszeichne: Um zu siegen,
«messieurs, il nous faut de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace».
(2. September 1792) Mut und Courage.