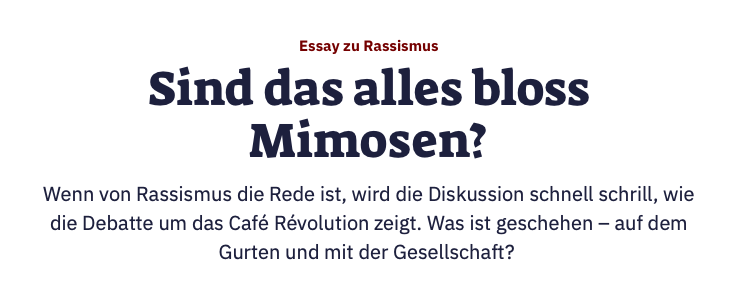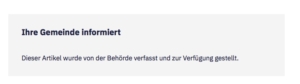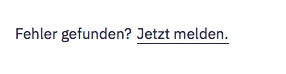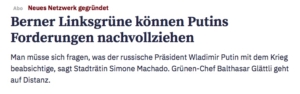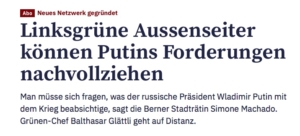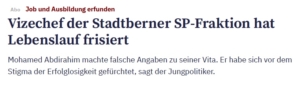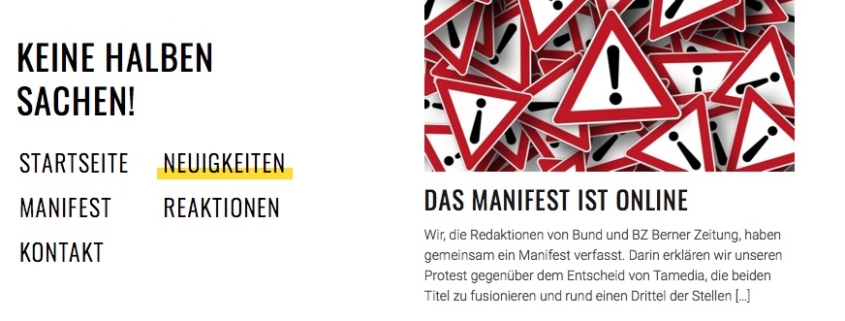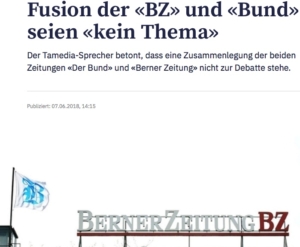Verschlimmbessert
Die «Berner Zeitung» klappert nach.
Nachdem eine «erfahrene» Journalistin unbelegte Vorwürfe über Diskriminierung und Rassismus am Gurtenfestival kolportiert hat, wofür sie vom Kommentarschreiber kräftig kritisiert wurde, will sich die «Berner Zeitung» weiter lächerlich machen.
Die Kommentarfunktion klemmte sie zunächst kommentarlos ab und spülte auch alle bereits publizierten Meinungsäusserungen der Leser. Das sei leider «aus technischen Gründen» nicht anders möglich. Aber immerhin wurde versprochen, dass man dem Thema Rassismusvorwürfe weiter nachgehe. Da denkt der Leser an eine Recherche, an den Versuch, endlich den Mitgliedern des Kollektivs «Café Révolution» eine Aussage zu entlocken, was denn genau passiert sei.
Auch ZACKBUM hat sich mit dieser Frage an die dort versammelten Frauen gewendet – keine Antwort. Beim erfolgreichen Crowdfunding über 30’000 Franken hatte das Kollektiv noch getönt: «Ist die letzte Etappe erreicht, können wir Dir im café révolution ein umfangreiches kulturelles Programm anbieten: Lesungen, Schreibworkshops, Yogasessions, Filmabende, Konzerte, Kunstaustellungen – the sky is the limit! Die Events sollen sozialkritische Themen aufgreifen und das Bewusstsein für diese Themen schärfen. Damit kommen wir unserer gesellschaftlichen Verpflichtung nach und bauen Brücken.»
Ein Blick auf die angepriesenen «Events» ist aber ernüchternd; es herrscht weitgehend – wenn der Begriff nicht rassistisch konnotiert gelesen werden kann – tote Hose:

Aber die BZ macht’s noch schlimmer, denn Ane Hebeisen ergreift dort das Wort. Pardon, er schreibt ein «Essay». Auch so ein Begriff, der völlig verludert ist. Das war mal ein brillanter Versuch, intellektuell hochstehend zu einem bedeutenden Thema etwas Wichtiges, Erkenntnisförderndes zu sagen.
Heute ist ein Essay in der BZ ein «ich mein› halt auch mal was und holpere das schriftlich vor mich hin». Hebeisen ist einschlägig bekannt, er rumpelte schon gegen das Rammstein-Konzert in Bern: «Die kruden Fakten zuerst: Die beiden Rammstein-Konzerte in Bern am Samstag, 17., und Sonntag, 18. Juni, werden – Stand heute – stattfinden … Aber auch auf ganz praktische Fragen gibt es bislang keine Antwort. Etwa auf jene, ob man sich sein Ticket zurückerstatten lassen kann, wenn man jetzt keine Lust mehr auf ein solches Konzert hat.»
Aber nun gar ein «Essay». Woran überhebt sich Hebeisen? Zunächst beschreibt er liebevoll die Tätigkeit dieses Kollektivs: «Die Einnahmen dieser Spenden kamen heuer dem Café Révolution zu, einem Begegnungsraum, in dem sich People of Color zum Thema Rassismus austauschen können, wo Lesungen oder Diskussionen stattfinden.»
Aber auch ihm wollte das Kollektiv nicht mal «auf mehrmaliges Nachfragen weitere Erklärungen abgeben». Es bleibt also dabei: leere Behauptungen von Diskriminierungen und Rassismus. Ein Hohn für alle wirklichen Opfer, die es natürlich gibt. Aber statt ein Essay über diesen eklatanten Missbrauch zu schreiben, behauptet Hebeisen: «Aus dessen Umfeld war später zu erfahren, dass wiederholt das N-Wort gefallen sei, dass Becher vor die Füsse der Einsammlerinnen geworfen wurden, mit der Aufforderung, sie sollten sich die Spende verdienen. Es sind Teller gegen den Stand geflogen, und mindestens eine Person soll angespuckt worden sein.»
Beweise, Belege, Videos gebe es allerdings nicht. räumt der Essayist ein. Keine Videos an einem Musikfestival, wo es mindestens so viele Handys wie Besucher gibt? Aus dieser Nicht-Tatsache macht Hebeisen dann flugs ihr Gegenteil: «Tatsache ist: Es muss eine Stimmung geherrscht haben, welche die Frauen dazu bewog, lieber auf Einnahmen des Standes zu verzichten, als länger an diesem Festival zu bleiben.»
Das ist keine Tatsache, sondern eine Beschreibung der unverständlichen und unbegründeten Reaktion des Kollektivs. Dass sie auf die Einnahmen verzichteten, stimmt auch nicht, sie mussten nur nicht mehr selbst sammeln.
Dann macht Hebeisen genau das Gleiche wie das Kollektiv. Er behauptet. Er behauptet, in der Kommentarspalte habe «die Stimmung begonnen hochzukochen». Leider kann das der Leser nicht nachprüfen, und auch Hebeisen – in bester Tradition – bringt keinen Beleg. Er behauptet: «Der Grundtenor in der Diskussion: Gegen Rassismus zu sein, sei eine linksextreme, politische Einstellung. Das seien alles Mimosen. Rassismus gäbe es bei uns nicht. Und wenn doch, seien die Betroffenen selber daran schuld.»
Das mag vielleicht eine fragwürdige, sogar falsche Ansicht sein, angesichts der haltlosen Vorwürfe zudem verständlich, aber Hochgekochtes ist hier nicht zu erkennen. Dennoch behauptet Hebeiesen weiterhin belegfrei: «Herrschte auf der Redaktion zunächst die Haltung, das Café Révolution schade sich selber, wenn es seine Vorwürfe nicht weiter ausführe, kippte die Stimmung bald. In einem derartig feindlichen, gehässigen und polemischen Umfeld würden selbst wir niemandem raten, sich mit Gesicht und Namen zu exponieren.»
Mit Gesicht und Namen exponieren? Wieso das? Es wurde doch nur verlangt, dass das Kollektiv ein paar Beispiele für seine Behauptung liefere; niemand verlangt, dass das mit «Gesicht und Namen» zu erfolgen habe.
Aber nun wird’s fatal, denn Hebeisen legt sich in die Kurve zu seinem eigentlich Anliegen: «In der Summe gibt es aber eine Ahnung davon, in welch unangenehmem Kraftfeld man sich als Person anderer Hautfarbe in diesem Land immer noch bewegt. In einem Land notabene, in dem die grösste politische Partei gerade beschlossen hat, die Migration als Quell allen Übels zu definieren, und damit zusätzlich einer ausländerskeptischen Enthemmung Bahn brechen dürfte.»
Enthemmung? Was heisst hier Enthemmung Bahn brechen? Natürlich muss man nicht lange auf das abgelutschte Allerheilwort warten: «struktureller Rassismus». Aber dann will Hebeisen «Klartext» schreiben: «Ja, die Schweiz hat ein Rassismusproblem, weil hier Menschen wegen ihrer Herkunft, wegen ihres Aussehens oder auch schon nur wegen ihres Namens nicht nur von vielen als «störend» empfunden werden, sondern auch tagtäglich Nachteile erfahren.»
Das mag nun so sein, aber was hat das mit dem Problem zu tun, dass hier ein Kollektiv für medialen Aufruhr sorgt, indem es wilde Behauptungen ausstösst und bislang den wirklichen Opfern von Rassismus damit einen Bärendienst erweist?
Dann wird’s noch einen Moment persönlich-peinlich: «Ich bin seit bald 20 Jahren mit einer afrobrasilianischen Frau verheiratet, die kein grosser Fan ist von sogenannten Safer Spaces für People of Color.»
Den langen Rest des Essays macht sich Hebeisen noch Gedanken, wo denn nun Rassismus beginne, wie man ihm begegnen könne und was es für Lösungsmöglichkeiten gäbe. Auf welchem Niveau? Na, auf dem hier: «Ich zitiere wieder meine Gemahlin: Schwingen wir nicht gleich bei jedem Anfangsverdacht die Rassismus-Keule!»
Da ist der Leser dann wirklich erschlagen. Ist das in der Gesamtwirkung peinlich. Kommentar kann Tamedia nicht. Reportage auch nicht. Essay ebenfalls nicht. Wofür will dann das Medienhaus überhaupt noch Geld verlangen? Für einkopierte Artikel aus München?