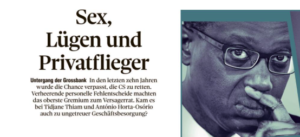Macht’s die SoZ besser?
Die Antwort ist nein.
Drei Anrisse zuoberst, dreimal schnarch. Dann darf Alain Berset in einem Interview letzte Zweifel aufräumen, dass sein Abgang überfällig war. Und wenn einer Redaktion überhaupt nichts mehr zu einem Thema einfällt, dann bleibt immer noch als letzter Joker der «Schweizer Aspekt».
Anschliessend wimmelt es nur so von Schweizer Aspekten. Niemand wäre bereit gewesen, Alain Berset ein solches Weichspüler-Interview zu schenken – ausser der SoZ. Dann etwas Schweiz – EU (schnarch), etwas Nachbereitung der Bundesratswahlen (gähn), etwas Mitleid mit Hans-Peter Portmann, Alt-Neues von Ritalin, das Ausland bestreitet sowieso die »Süddeutsche Zeitung» (oder interessiert es wirklich jemanden, dass Mexiko eine Eisenbahnlinie gebaut hat?), und die Qual des ersten Bundes ist überstanden.
Was bedeutet, dass die Qual des zweiten beginnt. Ältere Leser erinnern sich noch dunkel: «Fokus», das bedeutete hochstehenden, verdichteten, aus dem Normalbrei herausragenden Journalismus. Vorbei. Normalerweise werden hier Interviews abgefüllt, die man gar nicht schnell genug überblättern kann. Diesmal wird die Geschichte zweier Schweizer erzählt, die am 7. Oktober in Israel ermordet wurden. Bei aller persönlichen Tragik: was soll das?
Dann: Neues von übergriffigen Pfaffen. Oh Himmel, hilf. Auf Seite 25, das ist immerhin was zum Lachen, kolumniert Markus Somm ungebrochen weiter und tut so, als wäre da nix. Was wäre? Nun, dass sich der grosse Polit-Analyst und scharfe Seher mit seiner Prognose, dass ein Geheimplan Bundesrat Cassis aus dem Sessel kippen würde, was mehr als 50 Prozent Wahrscheinlichkeit aufweise, ganz grob verhauen hat. Aber es ist eine alte Weisheit von Sehern: geht was in die Hose, einfach nicht drüber reden und die nächste Prognose raushauen. Irgendwann landet man doch einen Treffer.
Oder, andere steile These von ZACKBUM, die SoZ lässt Somm weiter schreiben, damit die bodenlose Niveaulosigkeit von Gülsha Adiliji nicht so auffällt. Neuste Duftmarken: «Diese ganze Dating-Scheisse … ich downloadete (schon fucking wieder) … Dating ist jetzt nicht mein Lebensmittelpunkt-Lebensmittelpunkt, aber …» Wer dieses Gestammel freiwillig liest, darf sich nicht über den Preis des SoZ-Abos beschweren.
«Wirtschaft»? Ach ja, wenn Arthur Rutishauser nicht wäre, der auf Thomas Jordan eindrischt, wäre auch dieser Bund reif fürs Altpapier.
Apropos alt, Keith Richard wird 80. Wahnsinn. Der Mann, der Pate für den Spruch stand: der sieht so alt aus, so alt kann der gar nicht werden. Zur Feier des Tages ein Interview mit ihm. Exklusiv für die SoZ. Wahnsinn. Hm; der Autor ist Joachim Hentschel. Genau, der deutsche Journalist, der von der «Zeit» abwärts so ziemlich alle bedient.
Bleibt da noch ein Auge trocken? Ach, nicht wirklich, wenn wir zum Ratgeberteil kommen: «So gelingt das Weihnachtsessen zu Hause». Echt jetzt? Selbst dafür ist der Leser zu blöd, wenn ihm nicht geholfen wird. Der nächste Ratgeber wäre allerdings in erster Linie etwas für Journalisten: «So schreiben Sie wie ein Genie. Tipps für KI-Tools». Wenn man den Artikel liest, scheint das aber nicht wirklich zu funktionieren.
Schliesslich, ZACKBUM lobt wieder mal seine hellseherischen Fähigkeiten, waren nicht vor Kurzem helle Töne, Weiss der letzte Schrei in der Inneinrichtung? Arme Leser, die dem gefolgt sind. Denn: «Helle, sanfte Töne galten lange als Lieblinge in der Inneneinrichtung. Doch der Trend scheint zu kippen». Scheint, so sicher ist’s noch nicht, aber vielleicht sollte man die frisch angeschafften hellen Möbel vorsorglich entsorgen.
In der Reihe «sagt da einer sponsored content?» wird auf einer Seite vermeldet, dass das Zürcher Savoy als Mandarin Oriental wiedereröffnet wird. Da sich die meisten SoZ-Leser problemlos ein Doppelzimmer ab 1200 Franken leisten können (doch, pro Nacht natürlich), ist das ein zielgruppenorientierter Service-Text.
Oder ohne Ironie auf Deutsch: reine Leserverarschung.