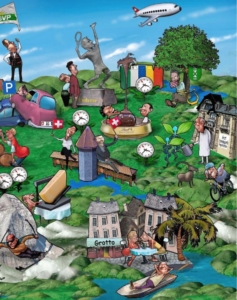1. August ohne Feuerwerk
Das gilt auch fürs Mediale.
Nehmen wir als Beispiel das Mittelmass. Also CH Media. Das Wanner-Imperium profitiert normalerweise davon, dass es zwar nicht so intellektuell ist wie die NZZ, dafür aber auch nicht so gender-kreischig wie Tamedia. Das erspart es CH Media häufig, in die ganz grossen Fettnäpfchen zu treten.
In die kleinen schon gelegentlich, wenn es sich auf Art des Hauses an der Hatz auf den ehemaligen Chefredaktor des «Magazin» beteiligt, dafür den Big Boss von Tamedia anrempelt – und zerknirscht eine öffentliche Entschuldigung vor den gelöschten Artikel stellen muss.
Idealtypisch wird Mass und Mitte vom Überchefredaktor Patrik Müller verkörpert. Kein Zufall, dass er inzwischen der einzige Überlebende des Triumvirats Christian Dorer, Arthur Rutishauser und eben Müller ist. Dorer wurde in ein «Nie mehr»-Sabbatical geschickt, Rutishauser wurde als Bauernopfer auf den Rang eines SoZ-Chefredaktors zurückgestuft.
Müller hingegen leitet, zeigt sich im «Sonntalk» und absolviert überhaupt einen Marathonlauf. Und schreibt den obligaten Kommentar zum 1. August.
Der fängt harmlos an: «Die Neutralität ist genial – aber sie braucht dringend einen neuen Anstrich.» Es gab da allerdings schon mal so einen Anstreicher, aber gut, Bilder sind so eine Sache. Dann wird Müller geschickt persönlich, Familienferien im Norden, Zwischenstopp in Brüssel, der zehnjährige Sohn tippt als Wunsch für Europa ein: «Neutral sein wie die Schweiz.»
Wunderbar, Leser abgeholt, sich als Familienvater gezeigt, schon Sohnemann beweist mit zehn Jahren politisches Bewusstsein. Bis hierhin wäre es einfach ein 08/15-Kommentar. Aber leider muss Müller dann Gas geben.
Neutralität sei identitätsstiftend, «solange daraus nicht Selbstgefälligkeit und die Neutralität nicht zum Götzen wird». Ohä, und wie könnte sie dazu denaturieren? Na klar, Ukrainekrieg: «Eigentlich war klar, dass es bei einem solch krassen Verstoss gegen das Völkerrecht keine neutrale Haltung geben konnte.»
Zuvor vergleicht Müller die Invasion der Ukraine mit dem Überfall Hitler-Deutschlands auf Polen. Ohne sich bewusst zu sein, dass die Schweiz damals auch neutral war – und blieb. Aber mit historischen Vergleichen ist es halt so eine Sache, wenn Leichtmatrosen unterwegs sind.
Die aber mit starken Worten nicht sparen: «Es scheint, als wirke die Neutralität wie ein politisches Narkotikum, auch mehr als ein Jahr danach: Das Aufspüren russischer Oligarchengelder gehen unsere Behörden im Halbschlaf an. Da erstaunt es nicht, dass aus den USA Vorwürfe auf die Schweiz einprasseln, sie finanziere Putins Krieg.»
Dann legt sich Müller wieder in die Kurve, das sein «grösstenteils pure Polemik». Aber eben, bei den nachrichtenlosen Konti sei anfänglich auch unterschätzt worden, welche Bedeutung Kritik aus den USA habe – «was den Ruf der Schweiz beschädigte und den Anfang vom Ende des Bankgeheimnisses markierte».
Richtig wäre allerdings, dass das der erste Anschlag auf die Schweizer Rechtssouveränität war, dem weitere folgten, bis sich der Bundesrat tatsächlich entschloss, US-Gesetze auch in der Schweiz gelten zu lassen. Was damals im Übrigen von ebendiesem Müller scharf kritisiert worden war. Aber seither sind einige 1.-August-Feiern ins Land gegangen.
Aber dieses Geholper soll nur auf die Zielgerade führen; die Bevölkerung sei schon viel weiter «als manche Ideologen in der Politik:Neutralität als Mittel zum Zweck statt als Selbstzweck. Entwickeln wir sie nicht weiter, so wie das seit ihrer Begründung 1815 wiederholt geschah, verliert sie ihre Genialität – und wird zum falschen Zauber.»
Das ist wieder einmal ein Gedankenflug, dem nur schwer zu folgen ist. Neutralität war noch nie Selbstzweck, was sollte das auch sein? Sie solle weiterentwickelt werden? Wieso nicht, kann man darüber diskutieren. Aber einleitend meinte Müller ja, dass es bezüglich des Ukrainekrieg keine Neutralität geben könnte. Hätte die Schweiz auch 1939 diesem Prinzip nachgelebt, wären aber wohl Diskussionen über Neutralität überflüssig; wozu auch in einem durch den Krieg zerstörten Land.
Werde sie nicht weiterentwickelt, offenbar in Richtung partieller Aufgabe, verlöre sie «ihre Genialität», werde gar «zum falschen Zauber». Genial an der Neutralität war und ist allerdings, dass sie beinhaltet, dass sich die Schweiz mit nichts und niemandem gemein macht. Weder mit der guten Sache, noch mit der schlechten. Wenn die gute Sache aber behauptet, wer nicht mit ihr sei, unterstütze die schlechte, dann muss man das aushalten und als machtpolitischen Egoismus durchschauen.
Statt schon wieder auf den falschen Zauber der USA hereinzufallen. Die haben tatsächlich das Schweizer Bankgeheimnis geknackt. Und sind seither noch unbestrittener der sichere Hort für Schwarzgeld, für kriminelle Gelder, betreiben die grössten Geldwaschmaschinen der Welt, in denen Milliarden Drogengelder blütenweiss werden – und pfeifen auf jede Teilnahme an Informationsaustauschsystemen wie den AIA. Im Gegenteil, mit ihrer Datenkrake FATCA zwingen sie alle Finanzhäuser der Welt, mittels der Weltmacht Dollar, alle Informationen herauszurücken, auf die die USA lustig sind. Umgeht gilt allerdings nicht.
Das ist falscher Zauber, nicht das Festhalten an der Schweizer Neutralität. Vielleicht sollte sich Müller doch leichtere Themen für seinen 1.-August-Kommentar aussuchen.










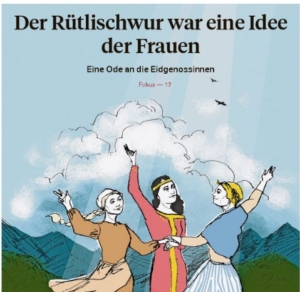


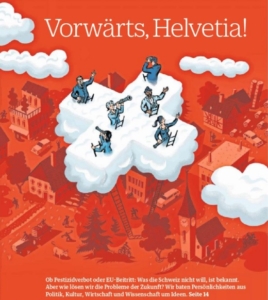

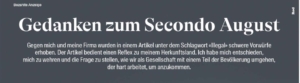

 Der Bundespräsident will mal was Markiges sagen, das Blatt was Banales.
Der Bundespräsident will mal was Markiges sagen, das Blatt was Banales.