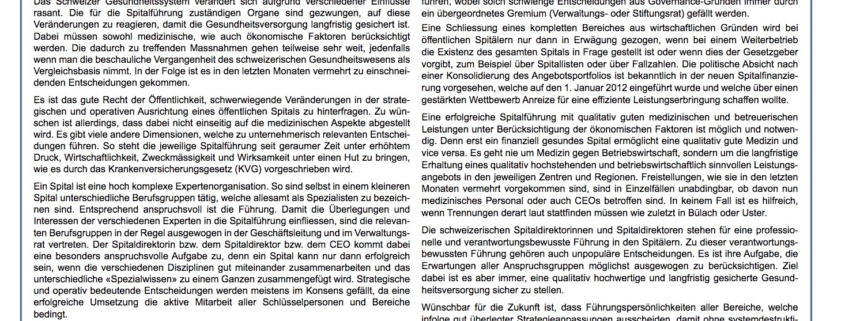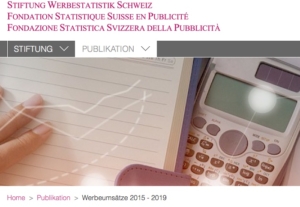Das Märchen von «pay per click»
Gnadenloses Treffen der Zielgruppe, seriöse Abrechnung. Echt?
Die einen nerven sie ungemein, die anderen verdienen ungemein Geld damit. Vor allem die grossen Internetkraken wie Google und Facebook & Co. Die räumen zusammen rund 90 Prozent des Schweizer-Online-Marketing-Markts ab.
Darum herum kreisen Dienstleister, die die Zeichen der Zeit erkannt haben und behaupten, ein Internet-Inserat wirke ungemein. Man könne die Zielgruppe randscharf einstellen, minimale Streuverluste. Und dank «pay per click» könne der Auftraggeber haargenau sehen, wie oft sein Werbemittel angeklickt wurde, minimiert zusätzlich den Streuverlust.
Die grossen drei Werbeverbände der Schweiz publizieren zusätzlich jedes Quartal jeden Menge Zahlen. Darunter die sogenannte Sichtbarkeitsrate für Werbeeinblendungen und zu Ad Fraud, also Beschiss in jeder Form.
Alles laufe super
Überraschenderweise kommen sie zum Schluss, dass alles super laufe. Die Sichtbarkeitsrate sei zwar leicht auf 59,2 Prozent gesunken, habe dafür aber im Mobilbereich auf 61,4 Prozent zugelegt. Ad Fraud liege bei unter 2 Prozent, und gewonnen habe man diese Erkenntnisse durch die Untersuchung von 4,22 Milliarden Ad Impressions.
Da traut sich der Laie wie üblich nichts dazu zu sagen, weil er nur Bahnhof versteht. Will er nur schon die Messmethode wissen, bekommt er weiteres Kauderwelsch auf den Tisch geschüttet: Google Ad Manager, Integral Ad Science, Xandr. Sonst noch Fragen?
Nein, aber zunächst einige Erklärungen. Die Sichtbarkeitsrate gibt an, wie oft ein Display-Inserat mit mindestens 50 Prozent seiner Fläche mindestens eine Sekunde lang sichtbar war. Ob’s auch jemand angeglotzt hat und was der in einer Sekunde und 50 Prozent mitbekam: Ansichtssache.
Aussagekraft sehr überschaubar
Dann hätten wir noch die sichtbare Klickrate (CTR). Damit wird gemessen, wie viele Nutzer auf die Anzeige klickten. Die Sichtbarkeit wird dann üblicherweise im 1000er-Pack abgerechnet (CPM). Dann gibt es noch die Unterscheidung zu unsichtbar und vieles weitere Beigemüse.
Was heisst das nun alles? Dampfgeplauder. Dass ein Display so und so viele Male den Nutzer ärgerte, indem es aufpoppte, ist ungefähr so aussagekräftig wie die Ansage, dass dieses Werbeplakat im Weltformat täglich von 15’000 Menschen gesehen werden kann.
Aber da gibt es doch noch «pay per click», also der Kunde zahlt nur, wenn tatsächlich auf das Display geklickt wurde. Dieser Cost per Click (CPC) ist tatsächlich die geniale Idee, mit der Google zum Riesen wurde. Wer Werbung schalten möchte, zahlt keinen Fixpreis. Sondern er legt ein Budget fest, und darin bestimmt er, was ihm ein Klick wert ist.
Eine geniale Idee von Google, aber nicht betrugssicher
Wer also zehn Rappen pro Klick einsetzt, braucht sein Budget langsamer auf. Wer einen Franken einsetzt, schneller. Dafür wird sein Display auch prominenter und besser platziert. Das ist dann wenigstens eine sichere Sache?
Es geht. Denn in den Weiten und Tiefen des Internets treiben sich bekanntlich auch viele böse Buben, bzw. Programme herum. Mit einem kleinen Ausflug ins Darknet kann man sich einen kleinen Bot kaufen, den mit ein paar Handgriffen programmieren, und schon klickt der das Display eines Konkurrenten zu Tode.
Und wer kontrolliert schon nach, ob sein Display tatsächlich 70’000 mal gezeigt wurde, allerdings meistens nachts zwischen zwei und drei? Das ist natürlich nur eine Methode im sogenannten Ad Fraud, also bei Betrügereien.
Es gibt auch aufwendigere Tricks
Beliebt , wenn auch etwas aufwendiger, ist folgender Trick. Man bastelt eine Webseite, füllt sie mit spezifischen Keywords ab, die in Sachen Anzeigen die höchsten Umsätze liefern. Der Werbetreibende bucht hier, aber kein Schwein schaut. Dann gibt es noch Ad Stacking, Domain Spoofing, Pixel Stuffing und so weiter.
Welcher Schaden damit angerichtet wird, kann nur geschätzt werden; es soll sich weltweit immerhin um mehrere Milliarden Dollar handeln. Die Kosten gar nicht einberechnet, die wiederum andere clevere Agenturen kassieren, um ihre Mandanten vor Ad Fraud zu schützen.
Wir sehen also; das Versprechen, dass man im Internet haargenau seine Zielgruppe erreiche, Aufwand und Ertrag gnadenlos abgerechnet werden kann, sind halt das, was in der Branche üblich ist: Werbesprüche.