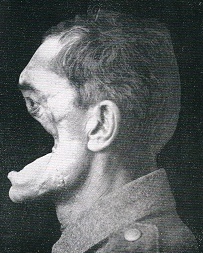Dichtung und Wahrheit, Teil 4
Wie stellt man Gerechtigkeit her, nach so vielen Jahren und so viel Unrecht?
Hier geht’s zu Teil eins, zu Teil zwei und drei.
Wer kann das viele, viele Jahre später noch unterscheiden? «Auch Leben ist eine Kunst», war der Sinnspruch von Max Emden.
Das Nachleben der von ihm erworbenen Kunstwerke ist dagegen ein Trauerspiel.
Es gibt die Nachkommen Emden. Denen Unrecht geschah, wie ihrem Vater, Grossvater, Urgrossvater Max Emden. Der eigentliche Skandal spielt sich bis heute in der Bundesrepublik Deutschland ab. Was die Nazis unter Anwendung von Judengesetzen Emden wegnahmen, könne leider nicht restituiert werden. Denn der damals als deutscher Jude Behandelte sei ja in Wirklichkeit ein katholischer Schweizer gewesen. Also leider keine Entschädigung.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Das soll natürlich keine Ablenkung oder Entschuldigung für allfälliges Fehlverhalten des Käufers dieses Bildes oder der seine Sammlung verwaltenden Stiftung sein. Fragwürdig ist auch das Verhalten von Publizisten und Historikern, die darauf ihre eigenen Süppchen kochen wollen.
Die beschämende Rolle von Daniel Binswanger in der «Republik» wurde hier schon gewürdigt. Aber noch elender ist die Rolle von Historikern, die aus der Eröffnung der Erweiterung des Kunsthauses Zürich sich nochmal ein Scheibchen Ruhm abschneiden wollten. Dabei gehen sie genau gleich wie Binswanger vor. Zunächst Lobeshymnen auf die Stiftung, dann wüstes Geschimpfe.
Wie Rico Bandle in der «Geschichte einer Schlammschlacht» (hinter Bezahlschranke) im Januar dieses Jahres aufzeigte, war der Historiker Erich Keller noch vor drei Jahren des Lobes voll über die «akribische Provenienzforschung der Stiftung Bührle». Dann aber meldete sich Keller mit einem Buch zu Wort: «Das kontaminierte Museum». 2021 wollte er im Rotpunktverlag aufzeigen, dass die Bührle-Forschung beschönige, gar Fakten unterschlage und daher auch nicht glaubwürdig sei.
Aus einer hässlichen Geschichte wird eine Heldensaga
Damit sorgte Keller international für Schlagzeilen, was seinem Ruf nicht schadete. Dahinter steckt allerdings zunächst eine hässliche Geschichte der Aufarbeitung der Vergangenheit der Bilder. Wie Keller beschönigend im Buch schreibt, sei er zwei Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Forschungsprojekts der Uni Zürich gewesen, mit dem die «historische Kontextualisierung der Sammlung Bührle» wissenschaftlich vorgenommen werden sollte. Dort habe er sich
«erfolgreich gegen beschönigende Eingriffe der Bührle-Stiftung und der Stadt Zürich gewehrt».
Wunderbares Narrativ, der tapfere Wissenschaftler widersteht üblen Manipulationsversuchen. Die Wirklichkeit ist wie meistens prosaischer. Der von der Uni ausgewählte Historiker holte sich Keller als Hilfe. Es kam zu Konflikten, Keller «sah sich als federführender Autor und wollte sich von seinem Vorgesetzten nicht mehr hereinreden lassen. Im Dezember 2019 eskalierte die Lage so weit, dass die Leitung des Historischen Seminars der Uni vermitteln musste», schreibt Bandle.
Erstnennung im Bericht gegen kollegiales Verhalten, wurde als Schweizer Kompromiss vorgeschlagen. Dennoch verliess Keller kurz vor Fertigstellung abrupt das Projekt. Ihm wurden kollegial die Korrekturen und Anmerkungen des Aufsichtsgremiums («Steuerungsauschuss») weitergeleitet, das zuvor versucht hatte, zu vermitteln.
Daraus machte Keller dann in der WoZ: «Die Eingriffe durch Mitglieder des Steuerausschusses und die Projektleitung wollen historische Fakten zum Verschwinden bringen.» Verschreckt liess die Uni den Bericht durch gleich zwei Gutachter durchleuchten, einen davon durfte Keller bestimmen. Das für ihn vernichtende Fazit des eigenen Gutachters: «Der vorliegende Bericht ist inhaltlich substanziell und insgesamt gelungen.»
Narrativ ist stärker als Chronologie
Das konnte aber am Narrativ, dass Keller die Untersuchung verlassen habe, um gegen Eingriffe und Zensur zu protestieren, nicht mehr aufhalten. Obwohl das auch chronologisch nicht stimmte: Der Steuerungsausschuss brachte seine Änderungsvorschläge erst nach Kellers Abgang ein.
Daraus ist inzwischen ein Jekami geworden. Die Linke lobt Kellers vermeintliche Winkelried-Aktion, über die störenden Fehler in seinem Buch wird grosszügig hinweggesehen. Kellers Gutachter, der Historiker Jakob Tanner, ist aber stinksauer auf Daniel Binswanger und sägte den bei einer Podiumsveranstaltung frontal an: «Was er geschrieben habe, sei «wissenschaftsfeindlich» und ein «infamer Angriff» auf ihn. «Das hatten wir bisher von rechts, aus der ‹Weltwoche›, jetzt ist es mitten in der ‹Republik› angekommen»», zitiert ihn Brandle maliziös.
Nachtreten statt Einsicht
Herrscht wenigstens etwas Einsicht unter den Historikern? Keineswwegs; Historiker Keller beschwerte sich in einem Schreiben an den Tamedia-Oberchefredaktor Arthur Rutishauser über diesen Artikel von Bandle. Auf fast drei Seiten stapelt Keller «Bandle behauptet, richtig ist» übereinander. Dagegen antwortete Bandle mit einem trockenen Zweiseiter. Ein Beispiel:
«In Ihrer Stellungnahme steht, es sei falsch, dass Lea Haller Erich Keller als ihren Nachfolger in der Forschungsgruppe vorgeschlagen hat. Dabei sagte Lea Haller an der Buchvernissage im Theater Neumarkt wörtlich: «(Ich) habe Erich dann vorgeschlagen als meinen Nachfolger. Das hat geklappt, er hat übernommen.» Auf folgendem Video ist dies festgehalten: https://vimeo.com/625316267 (ab Minute 7:00)»
Peinlich, sehr peinlich für einen der historischen Wahrheit verpflichteten Forscher. Viele von ihm (und seinem durch ihn angefütterten Fürsprecher Binswanger) erhobenen Vorwürfe sind falsch. Sowohl gegen den vernichtenden Artikel von Bandle wie auch, was die Beschreibung des Abgangs von Keller aus dem Uni-Forschungsprojekt betrifft.
Näher an der historischen Wahrheit scheint zu liegen, dass es zu Eifersüchteleien und einem Nahkampf kam, wer denn nun die Lorbeeren für diese Untersuchung einstreichen dürfe. Trotz Vermittlungsversuchen der Uni endete das im Krach und dem Abgang Kellers. Daraus bastelte er das Narrativ, dass er sozusagen im heldenhaften Kampf gegen Eingriffe von Bord gegangen sei, obwohl die seitens der Uni definitiv nach seinem Abgang erfolgten – und laut seinem eigenen Gutachter keinesfalls grobe Probleme beinhaltet hatten.
Man sollte nicht zurückgeben, wenn’s in die Hose geht
Nun könnte man sagen: probieren kann man immer. Aber dann sollte man nicht den Fehler machen, einem kritischen Artikel an den Karren zu fahren. Das mag nämlich der Autor auch nicht – und die Replik Bandles auf die Vorwürfe von Keller ist vernichtend.
Aber so ist’s halt mit Narrativen: Die Kampfschrift «Das kontaminierte Museum» gilt in Bührle-kritischen Kreisen immer noch als aufrechte und wissenschaftliche Glanztat. Obwohl es parteiisch, unsorgfältig und mit starker ideologischer Schlagseite verfertigt wurde.
Aber dem Narrativ – jüdische Raubkunst, durch Waffengeschäfte mit dem Dritten Reich reich gewordener Käufer, also mit Blutgeld billig bezahlte Fluchtkunst – wer kann dem schon widerstehen.
Was das Kunstmuseum Bern mit dem Gurlitt-Fundus macht, schreibt nebenbei ein weiteres trübes Kapitel im Thema Raubkunst. Von über 1600 Werken aus dem Nachlass Gurlitts erwiesen sich 14 eindeutig als Raubkunst – und wurden zurückgegeben.
Bei weiteren 29 besteht ein Verdacht. Einige von denen sollen nun an die Erben der damaligen Besitzer oder Verkäufer zurückgegeben werden. Obwohl deren Anspruch juristisch gesehen mehr als wackelig ist. Aber der Reputationsschaden, das Geschrei von Keller und Konsorten?
Kollateralschaden? Na und?
Auf der anderen Seite: welcher Sammler von Werken, die in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts den Besitzer wechselten, will seine Kollektion noch einem öffentlichen Museum überlassen? Wo er doch befürchten muss, dass Raubkunst zu Recht, aber auch im Falle von umstrittenen Besitzverhältnissen Werke aus seiner Sammlung in private Hände gehen und meistens damit der Öffentlichkeit entzogen werden?
Auch hier gilt:
Holzgeschnitztes Schwarzweiss ist immer eingängiger als die bunte Darstellung komplexer historischer Ereignisse.
Bandle war es schon gelungen, den Sohn des damaligen Kunstberaters von Emden Junior aufzutreiben. Der widersprach der Darstellung, der Sohn habe seine Verkäufe an Bührle vor und nach seiner Auswanderung nach Chile bitterlich bereut und sei dabei vom Waffenproduzenten übers Ohr gehauen worden. Emden Junior habe sich im Gegenteil bis zu seinem Tod nur wohlwollend und dankbar gegenüber Bührle geäussert. Aber was nicht ins Narrativ passt …