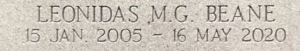ZHAW top, MAZ Flop
Corona-Lockdown und Ausbildung?
Während die ZHAW und zum Beispiel auch die Höhere Baugewerbliche Berufsschule Zürich praktisch von heute auf morgen auf den Online-Unterricht umstellten, tat sich das MAZ in Luzern bedeutend schwerer.
Der Modul-Kurs vom 13. bis 27. März der MAZ-Diplom-Ausbildung wurde einfach gestrichen. Grund: Corona-Lockdown. Das führte zu einiger Kritik. Denn das Schulgeld für die gut 90 Tage Schule beträgt happige 28400 Franken. Die 10 Kurstage sollen nun zumindest teilweise im Herbst nachgeholt werden. Schneller reagierte die ZHAW, die Fachhochschule Winterthur in der Fachrichtung Kommunikation. Schon nach einer Woche Lockdown wurde den Studentinnen und Studenten wieder Unterricht erteilt, per Email und Videochat. Zudem konnte man aufgezeichnete Vorlesungen herunterladen. Ähnlich lief es bei der Höheren Fachschule der Baugewerblichen Berufsschule Zürich. Dort setzte man auf das Improvisationsgeschick der Dozenten. Meist innert Tagen stellten diese auf digitalen Fernunterricht um. Kein Wunder, denn die Studenten wollen etwas geboten bekommen für die 17000 Franken. Diesen Betrag müssen die Studies umgerechnet auf gut 60 Tage Unterricht bezahlen.
Yanez ging, Fehr kam
Warum tat sich ausgerechnet das MAZ so schwer? Das Maz, das sich rühmt, das „führende Schweizer Kompetenzzentrum für Journalismus und Kommunikation“ zu sein. Ein möglicher Grund: Der Corona-Lockdown fiel ausgerechnet in die Zeit der Stabsübergabe von Diego Yanez an Martina Fehr. Die neue Direktorin übernahm die Leitung des MAZ am 1. Mai 2020. Fehr, die von der Somedia-Gruppe kam, will die Kritik nicht gelten lassen. Man habe die Kurse in der Diplomausbildung sowie im Radio- und VJ-Lehrgang virtuell fortgesetzt. „Einzelne Inhalte, die sich für den Fernunterricht nicht eigenen, werden im Herbst nachgeholt; dies gilt auch für Prüfungen“, so die 45-Jährige. Und auch Fachkurse wie Medienrecht, Online-Recherche, Verifikation von Fakten, Umgang mit PR oder auch Kurse in der Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Luzern habe man im Fernunterricht durchgeführt. Mussten Angebote gestrichen und/ oder zeitlich verschoben werden? Nochmals Fehr: „Umbuchungen haben wir insbesondere in der Abteilung Kommunikation vorgenommen. Die meisten Kurse und massgeschneiderten Angebote werden nun im Herbst durchgeführt. Einzelne Kurse mussten wir aber auch streichen“.
10 Prozent weniger Kurgeldeinnahmen – vor Corona
Den finanziellen Schaden kann Martina Fehr derzeit nicht beziffern. Schon von 2018 auf 2019 gingen die Kursgeldeinnahmen um eine halbe Millionen oder gut zehn Prozent zurück. Die Schulgelder der Kantone gar um 25 Prozent. Total betrug der Einnahmenverlust 547415 Franken – vor Corona. „Das zweite Semester ist für uns traditionell das umsatzstärkere. Was aber trotzdem klar ist: Wir werden den erlittenen Umsatzverlust im zweiten Halbjahr nicht aufholen können“. Das wiegt darum schwer, weil das MAZ sowieso immer stärker unter der Konkurrenz leidet. Das MAZ mit einem Trägerverein im Hintergrund gilt zwar als praxisnaher als die staatliche ZHAW, dafür aber auch als viel teurer. Entsprechend sinken die Anmeldungen in Luzern, während in Winterthur der Laden brummt.